Die Türkei auf ihrem Weg – wohin?
Autokratie, Diktatur oder faschistischer Staat?Autokratie, Diktatur oder faschistischer Staat?
Reiner Sinn
Die Türkei auf ihrem Weg – wohin?
Autokratie, Diktatur oder faschistischer Staat?Autokratie, Diktatur oder faschistischer Staat?
Reiner Sinn
Bevor ich versuche Antworten auf diese Frage zu geben, möchte ich ein gedankliches Experiment anstellen: Gesetzt den Fall, in zwei Monaten könnten in der Türkei freie Wahlen nach internationalen Normen stattfinden. Dazu würden unter OSZE-Aufsicht sofort alle bewaffneten Aktionen aller Seiten eingestellt. Alle Rechte einer freien Presse würden wiederhergestellt und nach den Wahlen würde mit EU-Hilfe wieder eine unabhängige Justiz aufgebaut und der öffentliche Dienst würde nach dem Vorrang fachlicher vor politischer, religiöser, ethnischer usw. Befähigung erneuert.
Wo wären Erdoğan und der größte Teil seiner AKP-Clique und des Sicherheitsapparates dann in einem halben Jahr?
Die Antwort kennen wir alle, und sie ist auch Merkel, Steinmeier, Hollande, EU-Schulz und Brexit-Johnson bekannt. Am besten kennt sie Erdoğan selbst und deswegen werden er und seine Leute vom einmal eingeschlagenen Weg nicht mehr abweichen: Sie haben inzwischen selbst für türkische Verhältnisse so viel Dreck am Stecken, dass sie ihn bis zum bitteren Ende gehen müssen:
- Da gibt es die Milliarden Dollar an Korruptionsgeldern seit seiner Zeit als Istanbuler Bürgermeister bis heute, die nicht nur er und seine Familie, sondern praktisch alle einflussreichen AKPler sich angeeignet und verteilt haben;
- da gibt es die Aushebelung der Unabhängigkeit der Justiz, der Hochschulen und anderer Institutionen in einer selbst für türkische Verhältnisse skandalösen verfassungswidrigen Weise;
- da gibt es schon vor der angestrebten Verfassungsänderung die Usurpierung unbegrenzter Macht durch den Staatspräsidenten;
- da gibt es die langjährige Duldung und Förderung des Einsickerns der Gülen-Bewegung in den Staatsapparat;
- da gibt es die Unterstützung von Al-Nusra/Al-Qaida in Syrien und vor allem des IS in Syrien und in der Türkei;
- da gibt es die gezielte Torpedierung des Friedensprozesses mit der PKK mithilfe von IS-Anschlägen und willkürlichen Verhaftungen;
- da gibt es schließlich die ganze Palette genozidaler Maßnahmen gegen die kurdische Bevölkerung, angefangen mit dem Zusammenbomben ganzer kurdischer Stadtviertel und Städte über Hinrichtungen und Schändungen von Guerillas, aber auch von Zivilisten, bis zur erzwungenen Flucht Hunderttausender und bis zur aktuellen fast kompletten Absetzung und Inhaftierung aller politischen Vertreter der kurdischen Bevölkerung.

All das legt es nahe, die heutige Türkei als »faschistischen Staat« zu bezeichnen. Zuvor sollte man allerdings genau überlegen, was Faschismus ist und was die Klassifizierung eines Landes, eines Staates bzw. seiner Regierung als »faschistisch« für Konsequenzen hat. Eine unreflektierte Verwendung des Begriffs Faschismus, quasi als reine Negativbezeichnung oder als Schimpfwort, macht zwar Stimmung, ist aber noch keine Analyse oder Strategie.
Zunächst einmal sollte man Faschismus losgelöst von der Türkei definieren. Anders als bei anderen politischen Systemen (z. B. Demokratie, Diktatur, Sozialismus, Kommunismus) haben allerdings selbst seine Protagonisten – also die »Faschisten« – nie erklärt, was Faschismus eigentlich ist.
Der Begriff »Faschismus« entstand mit den 1919 in Italien von Mussolini gegründeten »Kampfbünden« (»fasci di combattimento«). Mit der Bezeichnung »Kampfbund« wollten sich die italienischen Faschisten vom traditionellen, bürgerlichen Parteienwesen abgrenzen und ihren Gegnern gegenüber Geschlossenheit nach innen und Militanz nach außen zeigen. Nimmt man den ursprünglichen Faschismus wörtlich, so ist er in Ideologie und Praxis zunächst einmal ein kriegerischer Männerbund.
Nach der staatlichen Machtergreifung in Italien im Jahr 1922 entwickelte sich »Faschismus« zum Oberbegriff für zahlreiche rechte, reaktionäre und autoritäre Bewegungen und Regimes in Europa und der ganzen Welt.
Die Faschismustheorie, also die Theorie über die Gemeinsamkeiten der verschiedenen Faschismen, ist bis heute ein sehr strittiges Gebiet, auf dem viele Fragen ungeklärt sind.
Im Laufe der jahrzehntelangen Debatten haben sich für die meisten Faschismustheoretiker einige wesentliche Merkmale des Faschismus herauskristallisiert:
Als faschistisch werden moderne politische Bewegungen bezeichnet, die radikale Ideologien menschlicher Ungleichheit wie Nationalismus, Rassismus, Antisemitismus, Sexismus u. a. vertreten. Die Faschisten lehnen sowohl die bürgerliche Demokratie, den Liberalismus und den Parlamentarismus als auch die traditionellen linken Emanzipationsbewegungen wie Sozialismus, Kommunismus und Anarchismus und die neueren feministischen und antirassistischen Emanzipationsbewegungen ab. Faschisten streben eine autoritär-diktatorische Staatsform und eine gleichgeschaltete »Volksgemeinschaft« an. Faschismus ist nach außen hin aggressiv und er verherrlicht den Krieg, die Gewalt und die männliche Jugend.
Auch Imperialismus ist Kernbestandteil des Faschismus, denn alle Faschismen verfolgen das Ziel, die von ihnen erträumte neue faschistische Gemeinschaft – also normalerweise den faschistisch umgeformten Nationalstaat – in der internationalen Weltmarkt- und Mächtekonkurrenz möglichst stark bzw. unbesiegbar zu machen und ein großes Reich zu erhalten oder zu erobern. Dieses Streben lässt sich mit den anderen Bestandteilen der faschistischen Ideologien sinnvoll verbinden. Seine Gemeinschafts- und Hassideologien markieren den äußeren Feind der faschistischen Imperialismen. Das Streben nach größtmöglicher äußerer Machtentfaltung zieht eine Umformung der Gesellschaft in einen militärischen Kampfapparat mit elitär-diktatorischer Spitze nach sich. Einzelinteressen müssen dem imperialistisch-faschistischen Kollektivinteresse untergeordnet werden, Meinungsfreiheit und Meinungsstreit sind auszuschalten und alle (durch die Ungleichheits- bzw. Gemeinschafts- und Hassideologien) als feindlich, störend, bedrohlich und parasitär markierten Gruppen sind entweder zu unterwerfen und einzugliedern oder zu vertreiben bzw. zu vernichten.
Die faschistischen Ideologen haben zwei Gegner: einerseits alles Bürgerliche wie Demokratie, Liberalismus und Parlamentarismus, weshalb sie auch bestimmte Anteile des Kapitalismus scharf kritisieren. Andererseits lehnen sie mindestens ebenso scharf jegliche Emanzipationsbewegung ab, die den bürgerlichen Rahmen sprengen will, wie zum Beispiel den Kommunismus oder den Sozialismus.
Faschismus ist eine Kombination unterschiedlicher, aber miteinander vereinbarer konservativer, nationalsozialistischer und rechtsradikaler Bestandteile, die durch gemeinsame Gegner und gemeinsame Leidenschaften verbunden sind und das Ziel haben, um jeden Preis und vor allem um den Preis unabhängiger Institutionen und der Rechtsstaatlichkeit eine erneuerte, gestärkte und regenerierte Nation zu erreichen.
Faschismus entsteht vor allem dort, wo sich in Gesellschaften diffuse Annahmen, Gefühle und Ängste entwickeln konnten, die mit Opfergefühlen zusammenhängen:
- ein überwältigendes Krisengefühl, das traditionelle Handlungsoptionen auszuschließen scheint;
- der Glaube an die Vorrangstellung der eigenen Gruppe, gegenüber der man Pflichten hat, die über jedem Recht stehen, sei es individuell oder universell, und die deswegen die Unterordnung des Individuums fordert;
- der Glaube, die eigene Gruppe sei Opfer, was alle Handlungen gegen innere wie äußere Gegner ohne gesetzliche oder moralische Grenzen rechtfertigt;
- Angst vor dem Niedergang der eigenen Gruppe durch die »zersetzenden« Effekte von individualistischem Liberalismus, Klassenkonflikten und Einflüssen aus dem Ausland;
- das Bedürfnis einer engeren Integration, einer »reineren« eigenen Gemeinschaft, wenn möglich durch Konsens, wenn nötig durch ausschließende Gewalt;
- das Bedürfnis nach Autorität durch charismatische (immer männliche) Führungspersönlichkeiten, kulminierend in einem nationalen »Führer«, der als Einziger fähig ist, das Schicksal der Gruppe zu verkörpern;
- die Überlegenheit der Instinkte des charismatischen Führers über abstrakte und universelle Vernunft;
- eine Ästhetik der Gewalt und der Kraft des Willens, wenn diese dem Erfolg der Gruppe gewidmet werden;
- das Recht der Auserwählten, andere ohne die Schranken irgendeines menschlichen oder göttlichen Gesetzes zu beherrschen, ein Recht, das der Gruppe einzig nach dem Kriterium der Tapferkeit in einem darwinistischen Kampf zugemessen wird.
Abzugrenzen ist der Faschismus von klassischer Tyrannei. In der klassischen Tyrannei setzt der Tyrann seinen Willen gegen die Mehrheit der Bürger einfach mit roher Gewalt durch. Den faschistischen Führer unterscheidet vom Tyrannen, dass er sich von einem großen Teil der Bürger dazu aufrufen lässt, Demokratie und Rechtssicherheit zu beseitigen, und dies zur Untermauerung seiner Legitimität benutzt. Oder wie Erdoğan sagt: »Wenn die Bürger die Todesstrafe wollen, dann kann ich mich dem nicht verweigern.«
Wichtig ist auch die Abgrenzung zwischen Faschismus und autoritärer Herrschaft. Obwohl auch autoritäre Regimes die demokratischen Freiheiten niedertreten und äußerst brutal vorgehen können, wollen sie die Privatsphäre nicht auf Null reduzieren. Sie akzeptieren einen Rest von abgegrenzter Sphäre für traditionelle Instanzen wie lokale Honoratioren und Vereinigungen, für die Familien und für religiöse Institutionen. Diese sind in autoritären Staaten nach wie vor die Hauptakteure der sozialen Kontrolle und bleiben dies auch stärker als im Faschismus, wo mehr und mehr die faschistische Einheitspartei diese Funktion wahrnimmt. Autoritäre Führer lassen die Bevölkerung eher demobilisiert und passiv, während faschistische Führer die Gesamtheit der Gesellschaft erregen und mitreißen wollen. Autoritäre Führer wollen einen starken, aber begrenzten Staat. Sie wollen keine Wohlfahrtsprogramme oder Eingriffe in die Wirtschaft, welche im Gegensatz dazu die Faschisten bereitwillig initiieren. Nach dieser Definition war z. B. Spanien unter Franco nach dem Bürgerkrieg zwar eine Diktatur, aber keine faschistische Diktatur.
Wichtig ist für heutige Faschismustheorien die Betonung der Prozesshaftigkeit faschistischer Systeme. Wenn Faschismus eher Prozess als Zustand ist, dann ist das Endergebnis – der ausgebildete Faschismus – als Möglichkeit eines Faschisierungsprozesses vorhanden, er muss aber nicht unbedingt in Reinform eintreten. Die vor allem von Stalinisten hervorgebrachte These, dass Kapitalismus quasi automatisch zu Faschismus führt, ist deswegen falsch. In aller Regel planen Faschisten – meist Leute ohne analytischen Verstand, aber mit großem Ad-hoc-Aktionismus – nicht vorher, was genau sie erreichen wollen. Der charismatische faschistische Führer setzt seine Vorstellungen nicht nach Plan durch. Er greift eher die täglich schwankenden Stimmungen der Masse auf und berücksichtigt mal Forderungen dieses, mal Forderungen jenes Unterführers und regelt deren interne Machtkämpfe. Dabei schwebt er immer in der Gefahr, die Beute »ungerecht« zu verteilen oder heute die Entscheidung von gestern rückgängig machen zu müssen bzw. Sündenböcke für offensichtliche Fehlentscheidungen zu benennen.
Kommen wir zur Türkei. Die geschichtlichen Ereignisse auf dem Boden der heutigen Türkei und in deren Nachbarschaft in den letzten hundert Jahren waren der Entstehung faschistischer Mentalitäten sehr förderlich. Zu diesen Ereignissen zählen die verlorenen Balkan- und Kaukasuskriege des Osmanischen Reiches, in deren Folge Millionen Flüchtlinge (mucahir) aus diversen muslimischen Minderheiten, die vorher Opfer vielfacher Grausamkeiten gewesen waren, in das Gebiet der heutigen Türkei vertrieben wurden. Sie wurden vor allem auch in kurdischen und damals noch christlichen Gebieten Anatoliens angesiedelt. Man geht davon aus, dass etwa ein Drittel bis ein Viertel der heutigen Bevölkerung der Türkei Nachkommen solcher traumatisierter Mucahir sind. Diese Vorgeschichte sowie die Vielzahl von gegenseitigen Massakern, Plünderungen und Vertreibungen hinter permanent wechselnden Fronten zwischen osmanischen und russischen Truppen im mehrheitlich kurdisch-armenischen Ostanatolien machten es während des Ersten Weltkrieges der jungtürkischen Führung leicht, ihrerseits rund zwei Millionen christliche Armenier und Assyrer Anatoliens zu Verrätern und Feinden zu erklären. Sie wurden während des großen Genozids von 1915 enteignet und auf Todesmärschen – unter anderem auch mithilfe kurdischer Hamidiye-Truppen – umgebracht.
Die nächste Phase, der Zusammenbruch des Osmanischen Reiches, die Besetzungen im Osten und Südosten durch britische und französische Truppen, der Einmarsch einer griechischen Invasionsarmee und der vierjährige Unabhängigkeitskrieg 1919–1923 mit zehntausenden von Toten und dem Resultat eines Bevölkerungsaustausches von 500 000 Türken bzw. Muslimen nach Anatolien und 1,5 Millionen Griechen nach Griechenland schufen weitere Traumatisierungen, einschließlich der dazugehörenden Opfermythen.
Die kemalistische Bewegung, ein Teil der alten osmanischen Armeeführung unter Mustafa Kemal, hatte sich in dieser Situation entschlossen, in den anatolischen Resten des Osmanischen Reiches mit seinem Bevölkerungskonglomerat aus Türken, Mucahir und Kurden einen »modernen türkischen Nationalstaat« nach westeuropäischem Muster zu errichten. Solange seine Macht noch unsicher war, kaschierte Mustafa Kemal seine Absichten, indem er sich gegenüber den Notabeln Anatoliens als Vertreter des alten Regimes von Sultan und Kalif und als Retter des muslimischen Anatoliens gegenüber den christlichen Besatzungstruppen ausgab. Den kurdischen Stammesführern gegenüber erweckte er den Anschein, ihre alte Autonomie im Osmanischen Reich sei auch künftig sicher und im neuen Staat seien Türken und Kurden gleichberechtigt. Sobald aber die Armee reorganisiert und der Befreiungskrieg gewonnen war, wurde das kemalistische Modernisierungskonzept im Rahmen der Einparteienherrschaft der CHP gegenüber allen traditionellen Kräften und vor allem auch gegen die Kurden mit diktatorischer, brachialer Gewalt durchgesetzt. Viele der traditionellen, konservativen Kräfte rebellierten gegen diese Art der Modernisierung, zumal sich an den Lebensbedingungen der ländlichen Massen durch die kemalistischen Reformen nicht viel änderte. Allerdings riskierte jeder Oppositionelle, vor Revolutionsgerichte gestellt und hingerichtet zu werden. Besonders schlimm erging es schon ab 1920 den Kurden. Sie verloren nicht nur ihre angestammte Autonomie, sondern sie waren plötzlich dazu verdammt, sich wie ein Kolonialvolk, als angeblich »Unzivilisierte«, der neukonstruierten nationaltürkischen Moderne zu unterwerfen und sich assimilieren zu lassen. In einer Reihe von Aufständen, die jedes Mal blutig und menschenrechtswidrig niedergeschlagen wurden, versuchten sie sich dagegen zu wehren. Der letzte dieser Aufstände, der Aufstand der Dersim-Kurden von 1937/38 artete von Seiten der kemalistischen Truppen in ein regelrechtes Genozid aus.
Die kemalistische Phase zwischen 1924 und 1950 entspricht insgesamt weitgehend dem Typ der autoritären Herrschaft, was ihr Verhältnis zur Mehrheitsgesellschaft betrifft, und dem Typ der kolonialen Herrschaft, was ihr eigenes Verhältnis und das Verhältnis der Mehrheitsgesellschaft zu den Kurden und Kurdistan betrifft. Es gab im Kemalismus zwar Ansätze für Faschismus (Atatürk als charismatischer nationaler Führer, starke Militarisierung, Nationalismus bis zum Rassismus) und man orientierte sich in vielerlei Hinsicht an den gleichzeitig entstandenen Faschismen Italiens, Spaniens und Deutschlands, es fehlten aber die faschistische Massenbewegung und der imperialistische Expansionismus. In nennenswertem Maße waren vor allem die neue städtische Mittel-, Arbeiter- und Intellektuellenschicht Nutznießer und Unterstützer des Kemalismus.
Schon in der kemalistischen Phase entstand die Republik Türkei als absoluter Zentralstaat. Dies hat sich bis heute nicht geändert. Die jeweiligen Zentralregierungen haben und hatten alle Möglichkeiten, über die von ihnen eingesetzten Gouverneure und Landräte direkt in die Provinzen, Kreise, Städte und die hintersten Dörfer durchzuregieren. Eine kommunale Autonomie im europäischen Sinne, die vielleicht die schlimmsten Auswüchse der rigorosen Türkisierungspolitik hätte abmildern können, war und ist in der Türkei unbekannt. Dass dies für die kurdische Frage von besonderer Bedeutung ist, zeigt sich daran, dass die Regierung inzwischen ohne juristische Probleme alle Bürgermeister der kurdischen Gebiete absetzen konnte und von dieser Möglichkeit auch in der Vergangenheit reichlich Gebrauch gemacht hat.
Die geplante Einführung eines speziellen »türkischen« Präsidialsystems wird nun die letzten verfassungsmäßigen Reste einer Demokratie im westlichen Sinne beseitigen: Auch westliche Präsidialsysteme beruhen auf einer strikten Trennung von Legislative, Exekutive und Judikative. Im neuen Erdoğan-System wird der Präsident aber nicht nur zur Spitze der Regierung, also der Exekutive, sondern auch zur Spitze der Justiz. Er ernennt künftig die Hälfte der Richter im Verfassungsgericht, im Staatsrat, im Hohen Rat der Richter und Staatsanwälte (bestimmt über alle Personal-Angelegenheiten in der Justiz) und den Generalstaatsanwalt. Die Justiz wird also künftig formal unter der Vormundschaft von Erdoğan stehen. Zusätzlich erhält er starke legislative Rechte, indem einerseits Gesetze von ihm genehmigt werden müssen und er andererseits Gesetzesdekrete erlassen kann. Zusätzlich erhält er das Recht der Parlamentsauflösung. Künftig darf der Präsident auch Parteiführer sein. Da in den meisten türkischen Parteien Parlamentskandidaten von den Parteiführungen bestimmt werden, macht dies den Präsidenten künftig auch zum Chef der Mehrheitsfraktion des Parlaments, also der Legislative. Bei der ganzen Prozedur handelt es sich um die Etablierung einer Einparteien- und Einmannherrschaft – auf Deutsch die Etablierung einer Diktatur qua Verfassungsänderung.
Diese Diktatur verfügt bereits heute über einen immensen Sicherheitsapparat. Es ist nur wenig bekannt, dass die Türkei inzwischen führend auf dem Gebiet der Sicherheitstechnologie und ihres Einsatzes ist. Jeder vernünftige Mensch in der Türkei geht davon aus, dass Telefon- und Internetverbindungen weitestgehend überwacht werden. Außerdem werden flächendeckend alle Städte sowie viele Überlandstraßen und strategisch wichtige Orte in Kurdistan von Sicherheitskameras überwacht. Die Türkei gehört inzwischen auch zu den wenigen Ländern, die eigene Kampfdrohnen entwickelt haben. Es ist zu befürchten, dass sie demnächst in allen Teilen Kurdistans gegen die kurdische Bewegung eingesetzt werden.
Wie oben ausgeführt ist ein autoritäres Regime in Form einer Diktatur, wie brutal auch immer gegen Oppositionelle und Minderheiten vorgegangen wird, noch kein Faschismus. Eine Reihe von Fakten weist allerdings darauf hin, dass die Erdoğan-Türkei sich inzwischen auf dem Weg dorthin befindet:
- Im Gegensatz zur Staatsideologie der letzten neunzig Jahre vertreten Erdoğan und seine Clique inzwischen offen imperialistische Positionen, indem sie den Vertrag von Lausanne mit den bisherigen Grenzen der Türkei in Frage stellen.
- Während die Kemalisten die Republik Türkei immer als Erfolgsgeschichte einer aus den Trümmern des Osmanischen Reiches wiedererstandenen türkischen Nation unter dem Führer Atatürk dargestellt haben, stellt Erdoğan die Republikgeschichte als Produkt der Niederlage des von ihm glorifizierten islamischen Osmanischen Reiches gegenüber dem christlichen Westen und als Abkehr von den islamischen Werten dar. Er wertet so die Republikgeschichte in eine Opfergeschichte um, die nur er zu einer Siegesgeschichte wenden könne.
- In den Reden Erdoğans und in den Veröffentlichungen der ihm ergebenen Presse werden der »christliche« Westen und insbesondere die EU mehr und mehr als Feind dargestellt, dem es vor allem darum gehe, die inneren Feinde der Türkei zu unterstützen und die Türkei zu zerstören.
- Der Putschversuch vom 15. Juli diesen Jahres wird zum Gründungsmythos einer neuen Türkei bzw. einer Art neuem Osmanischen Reich stilisiert: Der hinterhältig mit dem Leben bedrohte Führer wurde von seinen Anhängern mit ihrem eigenen Blut vor den Feinden gerettet, um seine Mission weiterführen zu können. Dieser Heldenmythos ist inzwischen offizieller Lehrstoff in allen Bildungseinrichtungen.
- Erdoğan erklärt sich inzwischen selbst und öffentlich zum »Hirten«, der in Prophetenart eine »Herde« zu leiten habe. Er wird in dieser Selbsteinschätzung anscheinend von der großen Mehrheit der AKP-Mitglieder und von einem großen Teil der AKP-Wähler getragen. Dies entspricht dem typisch faschistischen Mythos vom geborenen Führer.
- Da man dem offiziellen Sicherheitsapparat nach dem Putschversuch nicht mehr traut, wird einerseits die AKP-Basis bewaffnet, andererseits werden aus Gruppen wie den Osmanlı Ocakları [»Osmanische Zentren«], die Erdoğan besonders ergeben sind, nun auch in der Türkei Kampfbünde wie im italienischen und deutschen Faschismus gebildet.
- Es ist davon auszugehen, dass sich eine Reihe weiterer, nicht direkt von Erdoğan kontrollierter islamistischer bewaffneter Gruppen (u. a. der IS) in der Türkei tummeln und dass nach wie vor diverse islamistische Sekten im Staatsapparat aktiv sind. Der Konkurrenzkampf dieser Gruppen wird wahrscheinlich die faschistische Radikalisierung der Gesellschaft weiter beschleunigen.
- Abschließend lässt sich feststellen, dass die Türkei derzeit zwar noch kein voll ausgebildetes faschistisches System darstellt, sich aber auf dem direkten Weg dorthin befindet. Es ist schwer vorstellbar, dass dieser Prozess noch auf friedlichem Wege aufgehalten werden kann.
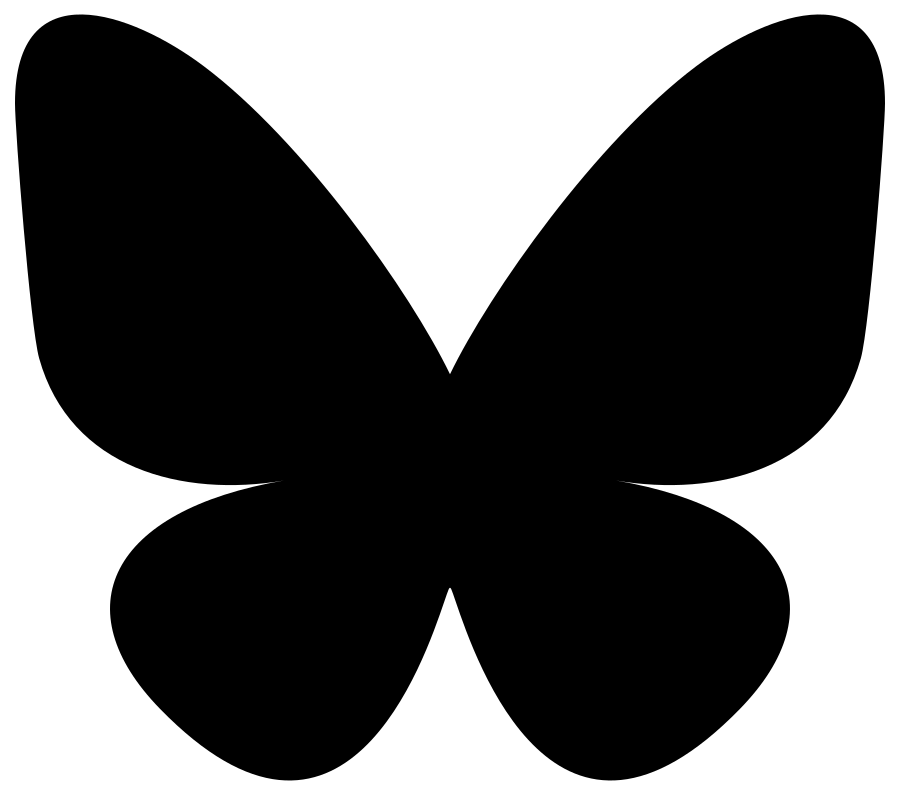

COMMENTS