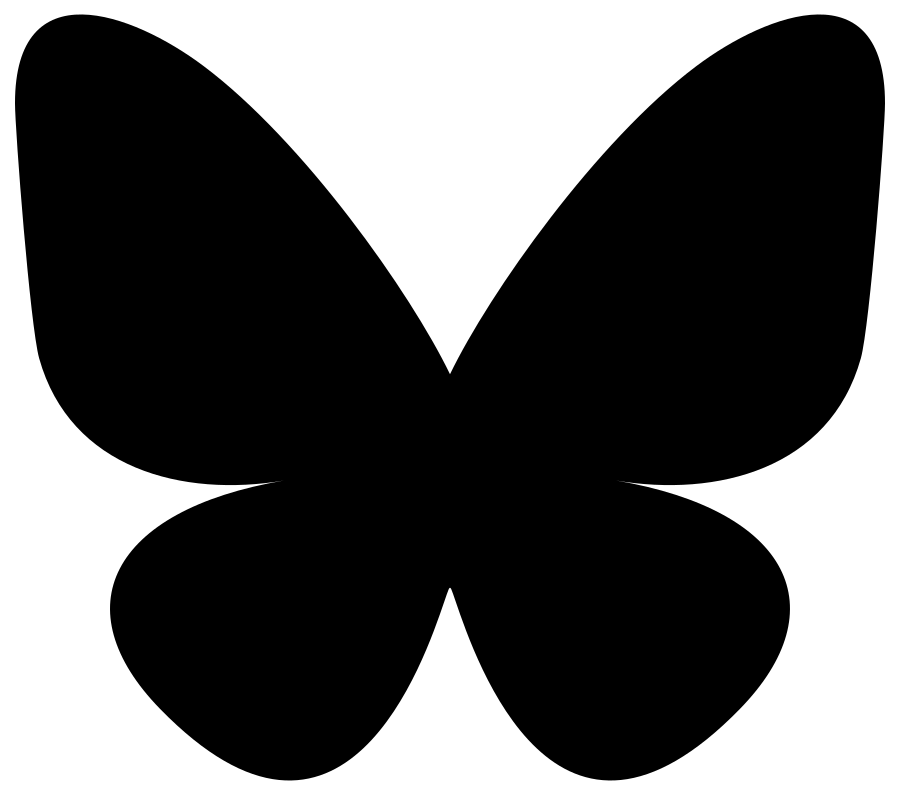Fabian Priermaier, Mitarbeiter von Civaka Azad (Kurdisches Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit e.V.)
Um sich einen Begriff davon machen zu können, worum es sich beim so genannten Spezialkrieg handelt, lohnt es sich zunächst, sich mit einer allgemeinen Definition von Krieg zu befassen. Aus dieser Perspektive ist Krieg allgemein ein Phänomen, das sich mit dem modernen Menschen in Relation zu den Hunderttausenden von Jahren menschlicher Geschichte insgesamt erst im Laufe der letzten Jahrtausende entwickelt hat. Krieg ist außer dem Menschen keinem anderen Lebewesen inhärent. Sicherlich kam es bereits unter den sogenannten Frühmenschen zu gewalttätigen Auseinandersetzungen, aber die strategische und planvolle Herangehensweise, die einen Krieg ausmacht, die Professionalisierung und Ausbildung von Kriegern sowie das Ziel der Vernichtung des Gegners oder der Eroberung eines gegnerischen Gebietes sind etwas, das sich erst seit wenigen Jahrtausenden vor der modernen Zeitrechnung entwickelte. Diese Entwicklung geht einher mit der Entstehung von Städten und Stadtstaaten, die zur Herausbildung von Herrschaft, Macht und Klassen führten. Kriege bildeten sich als politisches Mittel zur Besetzung und Neuaufteilung der Produktionsmittel mit der fortschreitenden Entwicklung der staatlichen Zivilisation heraus.
Eine heute geläufige Definition von Krieg stammt vom preußischen Generalmajor Carl von Clausewitz (1780-1831), der Krieg als »bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln« definierte. Von Clausewitz beschreibt, dass Krieg dann als Mittel zum Tragen kommt, wenn zwei im Konflikt miteinander stehende Parteien ihre Probleme nicht durch Dialog beilegen können oder wenn Parteien ihre Interessen nicht durch Diplomatie durchsetzen können. Als essentielles Ziel des Krieges wird definiert, dem Gegenüber den eigenen Willen durch Gewalt aufzuzwingen.
Sowohl der Blick auf die Entstehung von Krieg sowie auch des heute noch geläufigen Verständnisses davon heben bereits einen essentiellen Sachverhalt hervor – der Krieg ist ein Mittel des Staates. Die einzige Form des Krieges, die davon auszunehmen ist, ist der Selbstverteidigungskrieg der Völker. Diese stellt die einzige Form des Krieges dar, bei der das Ziel nicht das gewaltvolle Aufzwingen des eigenen Willens ist, sondern bei der es sich um einen Widerstand zur Befreiung handelt.
Widmen wir uns damit der Frage, was den Spezialkrieg als besondere Form des Krieges ausmacht. Die Ursprünge des Spezialkrieges finden sich bereits vor 2000 – 3000 Jahren. Dem bekannten chinesischen Militärstrategen und Philosophen Sunzi (auch Sun Tzu, 6. / 5. Jh. v. Chr.) wurde damals bewusst, dass ein Krieg nicht essentiell in der physischen Auseinandersetzung mit der Absicht der totalen Vernichtung des Gegners oder der vollkommenen Besetzung eines Gebiets entschieden werde, sondern dass ein Krieg stets um die Köpfe geführt und in den Köpfen gewonnen oder verloren werde.
Im Laufe der Jahrtausende entwickelte sich der vermeintlich »herkömmliche Krieg« in seinen Zielen, Mitteln und Methoden immer weiter und erreichte ab dem 18. Jh. und dann im 19. und 20. Jahrhundert zunehmend ein solch extremes Niveau, dass die Gefahr der Vernichtung der Menschheit und der Erde durch Krieg real wurde. So sahen die Staaten den Bedarf für ein Übereinkommen zur Definition »konventioneller Kriegsführung«. Damit wurde allerdings der darüber hinausgehende Krieg nicht verworfen. In Folge entstand der Spezialkrieg, ein Krieg, der keine Konventionen und Regeln kennt und sich keine Grenzen setzt. Weder gibt es eine offizielle Kriegserklärung, noch ein den Krieg abschließendes Friedensabkommen. Es sind keine Kriege, die zwischen zwei oder mehreren Staaten geführt werden, sondern es handelt sich um Kriege, die der jeweilige Staat gegen die Gesellschaft führt. Diese Kriege beziehen Ökonomie, Militär, Kultur und Politik sowie alles, was gegen den Menschen als Individuum und als politisch-moralisch organisierte Gesellschaft verwendet werden kann, mit ein.
Das zeigt aber auch deutlich, dass der Spezialkrieg ein bereits sehr altes Phänomen darstellt und bereits über eine gewisse Tradition verfügt, welche allerdings explizit nach dem Zweiten Weltkrieg an konkreterer bzw. qualitativ neu organisierter Struktur gewann. Der Zweite Weltkrieg als ein sogenannter »Heißer Krieg« hatte das oben angedeutete existenzgefährdende Niveau erreicht, an dem er faktisch eigentlich nicht mehr geführt werden konnte. Eine direkte militärische Konfrontation der beiden Hegemonialmächte, den USA im Westen auf der einen und der Sowjetunion im Osten auf der anderen Seite war aus existentieller Perspektive unmöglich geworden. Da aber in der Moderne Krieg zur entscheidenden Methode der Auseinandersetzung erhoben worden war, um systemische Entscheidungen zu treffen, musste eine neue Art der Kriegsführung entwickelt werden, die sich in der schon angedeuteten Welt der zwei Blöcke artikulierte und die mit Ausbrechen des sogenannten »Kalten Krieges« (1947-1989) einherging. Es begann eine Zeit der Stellvertreterkriege, der massiven Spionage, der Propagandakriege und der Versuche der Destabilisierung von Regierungen und Staaten. Während die Sowjetunion sich auf die Unterstützung der nationalen Befreiungsbewegungen in Lateinamerika und auch in Afrika fokussierte, lag ein essentieller Fokus der US-Amerikaner auf der Organisierung eines »Grünen Gürtels« im Mittleren Osten und im asiatischen Raum. Der erste umfassende Spezialkrieg der Weltgeschichte mit dem Fokus auf die Gesellschaft des jeweils anderen Blocks nahm damit seinen Anfang.
Die NATO wurde zur Koordinierung des Spezialkrieges mit dem Ziel gegründet, den globalen Einfluss der Sowjetunion zu begrenzen, die aufkommenden nationalen Befreiungsbewegungen weltweit zu stürzen und um unliebsame Regierungen abzusetzen und an ihre Stelle dem Westblock wohlgesonnene Regierungen einzusetzen. Selbstverständlich bildete die NATO nicht die einzige jener (militär-)politischen Strukturen dieser Zeit, allerdings war sie diejenige, die sehr umfassend, systematisch und äußerst erfolgreich arbeitete.
Entsprechend soll sich im Folgenden vor allem mit ihrer Entwicklung und Methodik befasst werden, um allgemein ein besseres Verständnis des Konzepts »Spezialkrieg« zu vermitteln.
Die Führung des Spezialkriegs oblag den Geheimdiensten, die dafür eigene Kommandozentralen auch hinter »feindlichen Linien« aufbauten. Die CIA konnte dabei zum Beispiel insbesondere viel von den Erfahrungen der deutschen Nationalsozialisten profitieren, rehabilitierte auch viele von ihnen, um sie direkt für die Realisierung eigener politischer Ziele einsetzen zu können. Die Struktur der NATO, die zur Koordinierung des Spezialkrieges auf NATO-Gebiet gegen sozialistisch orientierte gesellschaftliche Kräfte eingerichtet wurde, trug später den Namen ‚Gladio‘ (der Name leitet sich vom lateinischen Wort ‚gladius‘ ab – die Bezeichnung für ein kurzes römisches Schwert). ‚Gladio‘ war allerdings nur der Name der entsprechenden Struktur in Italien. Jedes Land baute eigene Strukturen auf, Deutschland beispielsweise die so genannte »Organisation Gehlen«, benannt nach Reinhard Gehlen, einem Generalmajor der Wehrmacht, der direkt nach dem Krieg in Kollaboration mit der CIA am Aufbau eines neuen deutschen Geheimdienstes arbeitete, dem er dann selbst mehrere Jahre als Leiter vorstand¹.
Während des Kalten Krieges befasste sich die NATO in erster Linie mit zwei sich ergänzenden Strategien. Zum einen meint das die Strategie des »Stay-behind«. Dabei ging es im Wesentlichen darum, dass Krieg nicht nur an der Front stattfindet, sondern in Form von asymmetrischer Kriegsführung, z. B. durch sogenannte »Schläferzellen« im Feindesland, die Sabotageaktionen durchführten, für gezielte Attentate eingesetzt wurden und allgemein sowohl auf militärischer als auch ziviler Ebene für Chaos sorgten. Ziel war es, so möglichst viele feindliche Kräfte zu binden, was zu einer allgemeinen Destabilisierung auch hinter den feindlichen Linien führen sollte. Zum anderen ging es um eine Präventionsstrategie, um das Formieren sozialistischer Strukturen sowie der Begrenzung des sich ausweitenden Einflusses der Sowjetunion bzw. des Ostblocks einzudämmen bzw. zu unterbinden. In diesem Rahmen wurden u. a. False-Flag-Attacken durchgeführt, die Bevölkerung terrorisiert und eingeschüchtert, konterrevolutionäre, oft auch islamistische Strömungen unterstützt und da, wo es keine gab, wurden subversive Gruppierungen gegründet und (mit)finanziert.
Neben den USA sind es besonders Italien, die Türkei, Griechenland, Spanien, Frankreich, Belgien und Deutschland, die sich dabei hervortaten und über die im Nachhinein am meisten bekannt wurde. Es ist schwer zu sagen, wie viele dieser Strukturen im Zuge des Zusammenbruchs der Sowjetunion und der Beendigung des Kalten Krieges aufgelöst wurden. In der Türkei beispielsweise erreichten diese Strukturen erst in den Jahren danach den Höhepunkt ihrer Aktivitäten. Und auch heute noch gibt es immer wieder Hinweise darauf, dass in der Türkei weiterhin solche Strukturen unter Namen wie JITEM oder Ergenekon² bestehen.
Allgemein kann gesagt werden, dass der Spezialkrieg in den 1990er Jahren nicht beendet wurde, sondern sich veränderte und eine neue Stufe und Qualität erreichte. Die NATO und ihre Verbündeten begannen sich neu aufzustellen, entwickelten Projekte wie die New World Order (NWO) und das Greater-Middle-East-Project. Auch andere Mächte wie China, Russland, Indien und Brasilien, die nach eigener Hegemonialmacht streben, entwickelten eigene neue Mechanismen zur effektiven Führung des Spezialkrieges. Es sind u.a. jene Entwicklungen, die von der kurdischen Freiheitsbewegung als Dritter Weltkrieg definiert werden.
Werfen wir nun aber noch einmal ein Auge darauf, welchen Strategien und Methoden der Spezialkrieg im Allgemeinen und im heutigen Informationszeitalter folgt. Prinzipiell lässt sich der Spezialkrieg heute in drei strategische Kategorien unterteilen:
1. Unkonventionelle Kriegsführung
2. Destabilisierung feindlicher und Einsetzung wohlgesinnter Machthaber
3. Psychologische Kriegsführung.
Der unkonventionelle Krieg lässt sich als ein Krieg beschreiben, der von keiner offiziellen (staatlichen) Armee geführt wird. Stattdessen werden Konterguerilla, Paramilitär, Privatarmeen, Banden, Gangs sowie sonstige Proxy-Kräfte eingesetzt.
Bei der Destabilisierung feindlicher und Einsetzung wohlgesinnter Machthaber lassen sich etliche Operationen, die von der CIA durchgeführt wurden, anführen. Beispiele dafür sind der Putsch in Guatemala (1954), in Brasilien (1964), in Chile (1973), die eingesetzten Machthaber von El Salvador zwischen 1979 und 1992, der Bürgerkrieg von 1979 bis 1990 in Nikaragua, die militärische Intervention in Panama 1989, der versuchte Putsch in Venezuela 2002 und in Haiti 2004 oder der Putsch in Honduras 2009.
Unter psychologischer Kriegsführung lassen sich jegliche Propagandaformen, jegliche Versuche, die Moral der feindlichen Kräfte zu untergraben und die Moral der eigenen Kräfte zu stärken, verstehen. Dabei ist wie oben erwähnt das Ziel nicht wie im klassischen Krieg die physische Vernichtung des Gegners oder die physische Besetzung eines feindlichen Gebietes, sondern die mentale Zersetzung oder die Kapitulation des Feindes, im besten Fall ohne dass ein einziger Schuss fällt. Dabei setzen die Elemente des Spezialkrieges immer auf die Vertiefung und Ausweitung bestehender gesellschaftlicher Konflikte und Spaltungen,zum Beispiel zwischen linker und rechter Politik, zwischen dem alewitischen und dem sunnitischen Glauben, zwischen der türkischen und der kurdischen Nationalität, zwischen Ost und West etc. Sie folgen dabei der altbekannten Formel des Teilens und Herrschens.
Wo im antiken Rom noch die Rede von »Brot und Spiele« war, was im faschistischen Portugal unter Salazar als »Fado, Fátima, Futebol« (»Musik, Religion, Sport«) übernommen und erweitert wurde, bezeichnet der kurdische Vordenker Abdullah Öcalan heute als »Spor, Seks ve Sanat« (»Sport, Sex und Kunst«). Diese drei Elemente bilden essentielle Waffen, die in der kapitalistischen Moderne gegen die Gesellschaft eingesetzt werden, um eine Gesellschaft des Spektakels am Leben zu erhalten. Gerade die Sexindustrie, mit ihrer massiven Ausweitung der Prostitution, Normalisierung des Konsums von Pornographie sowie der um sich greifenden Vergewaltigungskultur als Folge der sich immer weiter vertiefenden ungelösten Geschlechterfrage trägt dabei stark zu einem gesellschaftlichen Verfall bei, der immer eine Folge des Spezialkrieges ist.
Beim Spezialkrieg wird immer gezielt die Gesellschaft auf kultureller und ethischer Ebene attackiert. Im Namen der Moderne werden Kulturen und Traditionen aufgegeben, ein der Gesellschaftlichkeit schädlicher Individualismus vorangetrieben und ein Einheitsmensch geschaffen, der sich selbst seiner Natur und seinem eigenen Wesen entfremdet hat, ein Mensch, dem die Fähigkeit genommen wird, über sich selbst zu bestimmen, demokratisch zu handeln und der somit in vollkommene Abhängigkeit vom Staat getrieben wird. Der moderne Mensch sieht sich als der freieste in der Geschichte der Menschheit, aber er ist so sehr in Abhängigkeit geraten wie noch keiner vor ihm. Gerade die erschreckenden psychologischen Folgen dessen sind heute eindrucksvoller zu beobachten als jemals zuvor.
An dieser Stelle ist noch eine Ebene zu erwähnen, die sich vor allem in den letzten zwanzig Jahren rasant entwickelt hat. Im 20. Jahrhundert begann der Siegeszug der modernen Technologie. Nachdem sich bereits durch das Aufkommen von Zeitungen und dem Kino ganz neue Möglichkeiten der psychologischen und ideologischen Kriegsführung boten, wurden durch das Radio und den Fernseher in immer mehr Haushalten eine weitere Kettenreaktion ausgelöst, die dann noch einmal bei weitem übertroffen wurde durch die Entwicklungen und Möglichkeiten des Internets, der digitalen Medien und der künstlichen Intelligenz. Das Radio und der Fernseher hatten es zwar bereits in viele Haushalte und den Alltag der Menschen geschafft, doch waren sie noch begrenzt. Das heutige Internet und die digitalen Medien mit ihren Algorithmen, die nachweislich nicht weniger abhängig machen als harte Drogen, haben es nun aber geschafft, eine nahezu ununterbrochene und perfekt auf jedes Individuum zugeschnittene psychologische sowie ideologische «Bombardierung« zu ermöglichen. Sicherlich kann nicht geleugnet werden, dass die Technik, egal ob das Internet, die digitalen Medien mit ihren Algorithmen oder künstliche Intelligenz, auch positive Möglichkeiten besitzt, aber die genannten Medientechniken sind letztlich keine demokratisch kontrollierten Werkzeuge, die der Gesellschaft dienen. Dafür wurden sie nie geschaffen. Das soziale Netzwerk Facebook beispielsweise entstand bekanntlich aus der sexistischen Phantasie eines jungen Mannes, der eine öffentliche Plattform schuf, auf der jeder die äußere sexuelle Anziehung seiner Kommilitoninnen ohne deren Wissen und Einwilligung bewerten konnte.
Fazit
Die Methoden des Spezialkrieges sind überaus vielfältig, haben sich im Laufe der Zeit und mit den verschiedenen regionalen Realitäten immer wieder gewandelt, angepasst und wurden meist mit verheerenden Folgen weiterentwickelt. Der Versuch zusammenzufassen, was alleine das gezielte In-Umlauf-Bringen von Drogen, die gezielte Verwendung einer bestimmten Rhetorik oder das Streuen von Fake News bewirkt hat bzw. bewirken kann, wäre ein Projekt, das etliche Bücher füllen würde. An dieser Stelle muss vorerst der Versuch reichen, eine grobe Vorstellung dessen zu geben, was sich alles hinter dem unscheinbaren Wort ›Spezialkrieg‹ verbirgt.
Entsprechend soll sich zum Schluss noch kurz mit dem Begriff ›Spezialkrieg‹ an sich befasst werden. Der Begriff ist so im Deutschen wenig geläufig und wird meist im Kontext der kurdischen Freiheitsbewegung verwendet. Ursprünglich kommt er aus dem Türkischen ‚Özel Savaş‘ (‚besonders, spe-ziell‘ und ‚Krieg‘), wo er Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre aufkam und sich schnell verbreitete. Immer wieder sieht man in deutschen Texten, dass der Begriff schlicht als ‚psychologische Kriegsführung’ oder ‚asymmetrische Kriegsführung‘ übernommen wird, was allerdings wie oben beschrieben zu kurz gegriffen ist.
Die oben beschriebene Ausführung der historischen Entwicklung des Spezialkrieges erreichte mit dem NATO-Beitritt 1952 auch die Türkei. Der türkische Geheimdienst MİT (Millî İstihbarat Teşkilâtı) begann in enger Zusammenarbeit mit den NATO-Kräften, allen voran der US-amerikanischen CIA, entsprechend der in anderen Ländern zuvor gewonnenen Erfahrungen auch in der Türkei ein Stay-behind-Netzwerk unter dem Namen »Gladio« aufzubauen. Um diesem Netzwerk eine Struktur zu geben wurden dafür sogenannte »Besondere und Unterstützende Kampfeinheiten« (Hususi ve Yardımcı Muharip Birlikleri) gegründet, die in den USA ihre praktische Ausbildung durchliefen. Wenig später drangen dann Informationen über eine zusätzlich gebildete Struktur, den »Rat für Mobilisierungsforschung« (Seferberlik Tetkik Kurulu), nach außen. Dieser Rat wurde kurz darauf in »Amt für Besondere Kriegsführung« (Özel Harp Dairesi) umbenannt. Die Aktivitäten dieser Strukturen wurden dann unter dem Namen »Özel Savaş« – »Spezialkrieg« – bekannt.
¹ BND (Bundesnachrichtendienst), offiziell am 1.4.1956 gegründet.
² Ergenekon: Name einer Organisation in der Türkei mit Verbindungen zu Mitgliedern des Militärs und Sicherheitskräften des Landes