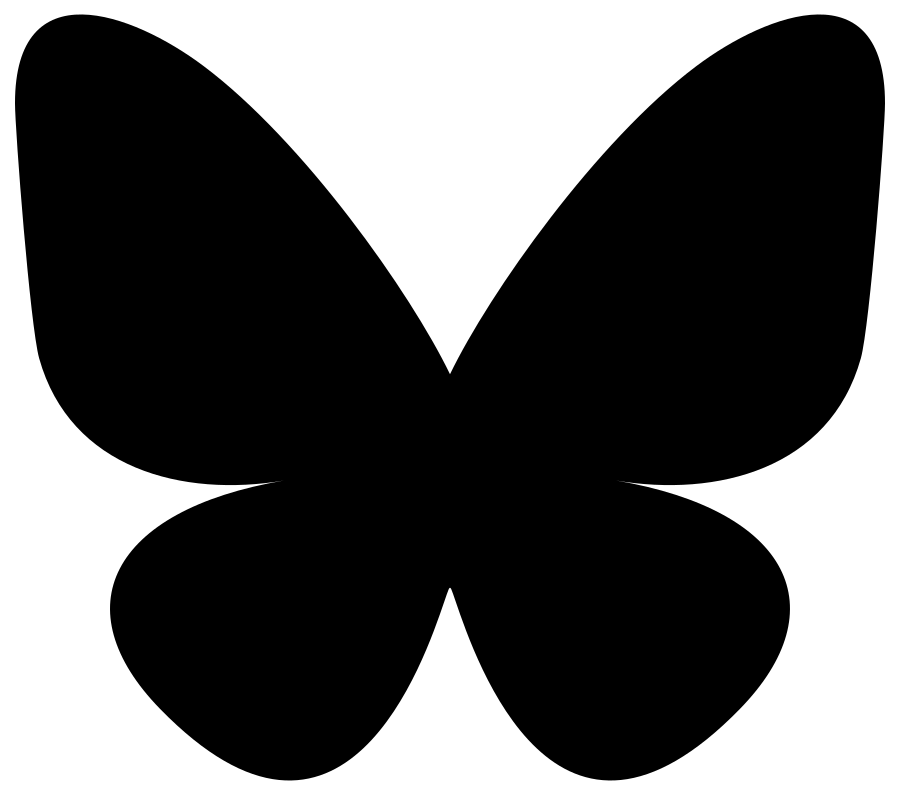Die Situation in Ostkurdistan (Rojhilat) nach den bilateralen Gesprächen zwischen Iran und USA¹
Zegrus Enderyari, kurdischer Aktivist aus Ostkurdistan
Der Iran ist ein multinationales Land, in dem verschiedene ethnische Gruppen mit unterschiedlicher Geschichte, Kultur und Sprache nebeneinander leben. Die zentralistische nationalstaatliche Politik der iranischen Regierung hat jedoch zur Marginalisierung und systematischen Unterdrückung einiger dieser Ethnien geführt. Die Kurd:innen – eine der größten und am stärksten historisch verwurzelten Nationen² im Iran – waren in den letzten Jahrzehnten mit zahlreichen Herausforderungen wie kultureller Diskriminierung, wirtschaftlicher Benachteiligung und politischer Unterdrückung konfrontiert. Die landesweiten Proteste in den Jahren 2022 und 2023, insbesondere in Ostkurdistan, markierten einen Wendepunkt. Die angesammelte Unzufriedenheit brach aus und signalisierte, dass die kurdische Frage nicht mehr nur eine lokale Angelegenheit, sondern Teil des nationalen und auch regionalen Diskurses geworden ist.
Die etwa 12 Millionen Kurd:innen im Iran leben vor allem in den Provinzen Kurdistan, Kermanshah, Ilam, Nord-Khorasan und West-Aserbaidschan. Die kurdische Identität, die in einer gemeinsamen Sprache, Kultur und Geschichte verwurzelt ist, steht seit langem im Konflikt mit der Homogenisierungspolitik der Zentralregierung. Nach der Revolution von 1979 wurden Hoffnungen auf die Anerkennung ethnischer Rechte, festgehalten in der Verfassung des Landes, geweckt. Die Artikel 15 und 19, die sich auf das Recht, die lokalen Sprachen zu erlernen und auf die Gleichberechtigung der Ethnien beziehen, blieben jedoch weitgehend unangetastet. Stattdessen dominierte innenpolitisch ein sicherheitspolitisch geprägter Umgang mit der kurdischen Bevölkerung, insbesondere nach den bewaffneten Konflikten der 1980er Jahre. Diese Politik in Verbindung mit wirtschaftlicher Unterentwicklung und Unterdrückung von zivilem Aktivismus vertiefte die Kluft zwischen der kurdischen Bevölkerung und dem Staat.
In den letzten Jahrzehnten, insbesondere nach der Revolution von 1979, stand die Islamische Republik Iran immer wieder im Mittelpunkt regionaler und globaler geopolitischer Spannungen. Eine ihrer wichtigsten außenpolitischen Achsen ist die Konfrontation – und zuweilen auch die Verhandlungen – mit den Vereinigten Staaten. In den letzten Jahren gab es Anzeichen für einen sowohl verdeckten als auch offenen Dialog zwischen dem Iran und den USA über die Wiederbelebung des ‚Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplans‘ (JCPOA), der komplexe Auswirkungen auf die politischen, wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Strukturen des Irans hat. Das JCPOA, auch bekannt als Iran-Atomabkommen, ist ein Abkommen aus dem Jahr 2015 zwischen dem Iran und den P5+1-Ländern (USA, Großbritannien, Frankreich, Russland, China und Deutschland) und der Europäischen Union. Ziel des Abkommens war und ist es, das iranische Atomprogramm im Gegenzug für die Aufhebung von Sanktionen einzuschränken. Das Abkommen sah Beschränkungen für die iranischen Atomanlagen vor und erlaubte internationale Inspektionen, um die Einhaltung zu gewährleisten. Es trat offiziell im Januar 2016 in Kraft. Im Jahr 2018 zogen sich die USA jedoch aus dem Abkommen zurück und setzten die Sanktionen wieder in Kraft. In Folge dessen wurden die wirtschaftlichen Vorteile des Abkommens sehr geschwächt. Die jüngsten indirekten Gespräche zwischen dem Iran und den USA – ob über Nuklearfragen, Sanktionserleichterungen oder regionale Deeskalation – könnten tiefgreifende Auswirkungen auf die ethnischen Gruppen des Landes haben. Nach vier Wochen indirekter Verhandlungen gerieten die Fortschritte plötzlich ins Stocken. Viele führten die Pause nicht auf technische Probleme zurück, sondern auf innenpolitische Veränderungen in den USA und zunehmenden Druck auf beide Seiten. Die Enthüllung einer neuen Nuklearanlage und Trumps veränderte Haltung gegenüber dem iranischen Atomprogramm erschwerten die Gespräche zusätzlich und die Aussicht auf Fortführung ist ungewiss.
Für den Ausgang dieser Gespräche können drei Hauptszenarien prognostiziert werden:
1. Wiederaufnahme der Gespräche und ein begrenztes Abkommen: Wenn sich beide Seiten über die Notwendigkeit einer Deeskalation einigen, könnte eine begrenzte Einigung erzielt werden, die sich auf Transparenz, eine Reduzierung der Urananreicherung und eine schrittweise Aufhebung der Sanktionen konzentriert. Dies könnte die Devisenmärkte stabilisieren, für eine vorübergehende Beruhigung im Land sorgen, und die Regierung könnte es als diplomatischen Erfolg feiern.
2. Das Scheitern der Gespräche und ein Wiederaufflammen der Eskalation: Sollte es nicht gelingen, eine Einigung zu erzielen – insbesondere unter dem Druck von Persönlichkeiten wie Marco Rubio oder der israelischen Lobby – , könnte dies zu verschärften Sanktionen, regionalen militärischen Spannungen, Cyberangriffen oder gezielten militärischen Schlägen gegen den Iran führen. Innenpolitisch könnte dies die Wirtschaftskrise verschlimmern, die öffentliche Unzufriedenheit verstärken und das Vertrauen in die staatlichen Institutionen weiter untergraben.
3. Stagnation und festgefahrener Stillstand: In diesem Szenario sind die Verhandlungen weder erfolgreich noch offiziell gescheitert und bleiben in der Schwebe, um die Krise durch Medienmanipulation zu beeinflussen. Strategisch gesehen könnten die USA einen direkten Konflikt vermeiden und gleichzeitig den Druck auf den Iran aufrechterhalten. Für den Iran würde dies eine anhaltende wirtschaftliche Stagnation, verstärkte Unterdrückung der Bevölkerung und weiteren politischen Stillstand bedeuten.
Aus geopolitischer Sicht erhofft sich der Iran von diesen Gesprächen folgende Ergebnisse:
– Aufhebung der Sanktionen und Zugang eingefrorener finanzieller Guthaben
– Verminderte internationale Isolation
– Weniger durch die Wirtschaftskrise verursachte soziale Unruhen
– Öffnung von politischen Kanälen für ein regionales Engagement
Die Hardliner und Teile der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) bleiben jedoch skeptisch. Sie argumentieren, dass ein Entgegenkommen gegenüber den USA das »Widerstandsnarrativ« schwächen und einen stärkeren westlichen Einfluss auf die iranischen Strukturen möglich machen würde.
Israel, ein zentrales Thema der iranischen Politik in der Region und in der politischen Ideologie des Landes fest verankert, hat seine Besorgnis über den gemäßigten Ton Teherans in den inoffiziellen Gesprächen mit Washington geäußert. Angesichts der zunehmenden iranisch-israelischen Spannungen in Syrien und im Libanon spekulieren einige Analysten, dass ein Tauwetter in den iranisch-westlichen Beziehungen zu einer geringeren Unterstützung für Stellvertretergruppen wie die Hamas und die Hisbollah führen könnte. Ein solcher Wandel würde jedoch auf den erbitterten Widerstand der revolutionären Gruppierungen im Iran stoßen. Parallel dazu würde die verringerte Unterstützung mit der verstärkten geheimdienstlichen und militärischen Zusammenarbeit zwischen Israel und den Arabern einhergehen. Das würde eine Veränderung des geopolitischen Gleichgewichts nach sich ziehen.
In Folge der zunehmenden Isolation hat die Islamische Republik ihre strategischen Beziehungen zu Russland und China verstärkt. Das 25-jährige Kooperationsabkommen mit China und die verstärkte Zusammenarbeit mit Russland im militärischen Bereich und in der Energiepolitik (abgeschlossen während noch der Krieg in der Ukraine anhält), sind Teil dieser Strategie. Die übermäßige Abhängigkeit von diesen Mächten hat den Iran jedoch zu einem zweitrangigen Partner, der keine greifbaren Vorteile bietet, gemacht. China balanciert die Beziehungen zwischen dem Iran und den arabischen Staaten aus, während Russland gelegentlich die Zusammenarbeit mit Israel in Syrien koordiniert.
Unterdessen könnte ein verstärkter Dialog zwischen dem Iran und den USA negative Reaktionen aus Russland und China provozieren. Der Iran befindet sich nun inmitten der Rivalitäten zwischen den USA und China und zwischen dem Westen und Russland. Das Land steht vor schwierigen außenpolitischen Entscheidungen.
Unterdrückte Nationen im Iran – Die kurdische Frage in einem neuen politischen Kontext
Vor dem Hintergrund einer sich wandelnden Außenpolitik bleibt die ungelöste und sensible Frage der ethnischen Minderheiten im Iran bestehen. Die Kurd:innen spielen eine historisch bedeutende Rolle und stellen einen großen Teil der iranischen Bevölkerung. Nach wie vor sind sie systematischer Diskriminierung, kultureller Unterdrückung, wirtschaftlicher Not und staatlicher Repression ausgesetzt.
Die landesweiten Proteste von 2022 bis 2023, vor allem in den kurdischen Regionen, zeigten die tief sitzende Wut, die ohne innenpolitische Reformen zum Ausbruch stärkerer sozialer Proteste führen könnte. Das iranische Kurdistan wird in Verbindung mit der wachsenden Unzufriedenheit im irakischen und türkischen Kurdistan zu einem Brennpunkt für legitime nationale Forderungen.
Wenn der internationale Druck nachlässt und sich der politische Raum öffnet, könnten die kurdischen Eliten auf eine echte Einbeziehung in das iranische Machtgefüge drängen. Es gibt jedoch immer noch keine Anzeichen für eine grundlegende Reform der kulturellen, sprachlichen, wirtschaftlichen oder sicherheitspolitischen Maßnahmen der Islamischen Republik gegenüber den Kurd:innen. Schlimmer noch, die Sicherheitskräfte setzen ihre auf Unterdrückung ausgerichtete Vorgehensweise gegenüber kurdischen Aktivist:innen aus der Bevölkerung fort.
Historische Wurzeln der kurdischen Unterdrückung: Von der Nationenbildung bis zum Iran nach der Revolution
Pahlavi-Ära: Die persisch geprägte nationalistische Politik von Reza Schah und Mohammad Reza Schah sowie die Unterdrückung kurdischer Bewegungen (wie der Mahabad-Republik³) legten den Grundstein für die strukturelle Diskriminierung.
Nach 1979: Entgegen anfänglicher Versprechungen, ethnische Rechte zu gewähren, legitimierte die neue Verfassung trotz vager Ergänzungen der Artikel 15 und 19 in Wirklichkeit die staatliche Repression in den kurdischen Gebieten.
Auf dem Papier erlaubt Artikel 15 ethnischen Gruppen, auch den Kurd:innen, ihre Sprachen und Kulturen zu bewahren und zu fördern. Die Amtssprache Persisch gilt für das ganze Land. Erlaubt wird »die Verwendung regionaler und ethnischer Sprachen in der Presse und den Massenmedien sowie das Unterrichten ihrer Literatur in den Schulen.« Artikel 19 der Verfassung verbietet ethnische Diskriminierung und legt fest, dass »alle Menschen im Iran, unabhängig von der ethnischen Gruppe oder dem Stamm, dem sie angehören, die gleichen Rechte genießen«.
Beide Artikel sind unverbindlich formuliert und zur Umsetzung fehlen die politischen Mittel. In der Praxis legte der Staat diese Bestimmungen restriktiv aus. Kurdischsprachiger Unterricht blieb in öffentlichen Schulen verboten, und lokale Kulturinitiativen wurden häufig zensiert oder geschlossen. Politische und kulturelle Aktivitäten der Kurd:innen wurden zunehmend nicht als ihr Recht, sondern als ein Problem der nationalen Sicherheit behandelt.
Dieser unklare Rechtsrahmen ermöglichte es der Islamischen Republik, die kurdische Identität zum Sicherheitsproblem zu erklären. Kultur und politische Organisierung wurden als Separatismus eingestuft. Infolgedessen wurden die kurdischen Regionen stark militarisiert und Aktivist:innen wurden häufig unter vagen Anschuldigungen wie »gegen die nationale Sicherheit handeln« verhaftet. Die ungenau formulierten Artikel 15 und 19 ermöglichten also eine systematische Unterdrückung unter dem Deckmantel verfassungsmäßiger Ordnung. Das Versprechen auf ethnische Teilhabe verwandelte sich in ein Instrument der staatlichen Kontrolle.
Bürgerkrieg der 1980er Jahre: Massenexekutionen (z. B. die Massentötung kurdischer politischer Gefangener 1988) und Bombenangriffe zeigten, dass das Regime die »physische Vernichtung« dem Dialog vorzog. Die iranische Regierung schien nicht die Integration der kurdischen Bevölkerung anzustreben. Stattdessen setzte sie ihre Ausgrenzung durch und behandelte die Kurd:innen als Bürger:innen zweiter Klasse.
Nach der Islamischen Revolution von 1979 hoffte die kurdische Bevölkerung im Iran auf Autonomie, kulturelle Anerkennung und demokratische Teilhabe. Diese Hoffnungen wurden jedoch schnell zunichte gemacht, als die neue Islamische Republik unter Ayatollah Khomeini die Forderungen der Kurd:innen ablehnte und sie zu Feinden der Revolution erklärte. Der iranische Staat startete eine Militärkampagne in den kurdischen Gebieten und entfachte einen brutalen Krieg im Land.Während der gesamten 1980er Jahre glich Kurdistan einem Kriegsgebiet. Kurdische Städte und Dörfer wurden häufig bombardiert und beschossen.
Die iranischen Streitkräfte durchkämmten die ländlichen Gebiete, verhafteten mutmaßliche Kollaborateure und zerstörten Häuser. Hubschrauber kreisten am Himmel, während Bodentruppen Haus-zu-Haus-Razzien durchführten. Ganze Gemeinden lebten in Angst und viele Familien waren gezwungen, in die Berge oder über die Grenze zu fliehen.1988 erreichte die Gewalt des Regimes ein neues Ausmaß. Nach dem Ende des iranisch-irakischen Krieges begann die Islamische Republik mit Massenhinrichtungen von politischen Gefangenen im ganzen Land. Unter den Opfern befanden sich hunderte – möglicherweise tausende – kurdischer Gefangener, von denen viele wegen gewaltloser politischer Aktivitäten bereits jahrelang im Gefängnis gesessen hatten. Sie wurden vor geheime Tribunale geladen, mit religiösen und ideologischen Fragen konfrontiert und innerhalb von Stunden hingerichtet – oft durch Erhängen. Die Leichen wurden in nicht gekennzeichneten Gräbern beigesetzt und ihre Familien erfuhren nie, wo oder warum sie gestorben waren.
Diese Ereignisse zeigen, dass die iranische Regierung die Kurd:innen nicht als Bürger:innen betrachtete, die integriert werden sollten, sondern als Bedrohung, die zum Schweigen gebracht werden musste. Anstatt sich auf einen Dialog einzulassen oder kulturelle Rechte anzubieten, entschied sich der Staat für Gewalt und Unterdrückung. Die 1980er Jahre waren für die Kurd:innen im Iran nicht nur eine Zeit des Krieges, sondern auch eine Zeit der systematischen Marginalisierung, des Traumas und der Auslöschung.
Gegenwärtige Unterdrückungsmechanismen
a) Kulturell-sprachliche Unterdrückung
– Verbot von kurdischsprachigem Unterricht, selbst in mehrheitlich kurdischen Gebieten
– eingeschränkte Publikationsmöglichkeiten für kurdische Bücher, Musik und Medien
– Persianisierung von geografischen Namen (z.B. die Änderung von »Sine« in »Sanandaj«)
b) Wirtschaftliche Unterdrückung
– Absichtlich herbeigeführte Unterentwicklung: Kurdische Gebiete rangieren durchweg auf den hinteren Plätzen der Entwicklungsindizes (Arbeitslosigkeit, Armut, fehlende Infrastruktur)
– Verhinderung öffentlicher und privater Investitionen
c) Sicherheitspolitisch begründete Repressionen
– Massenhinrichtungen: Der Iran hat die höchste Rate politisch begründeter Hinrichtungen von Kurd:innen weltweit (z. B. Farzad Kamangar, Shirin Alam-Holi)
– Willkürliche Verhaftungen: Selbst kulturelle Veranstaltungen werden mit Vorwürfen wie »Propaganda gegen das Regime« belegt
– Militarisierung: Die starke Präsenz der IRGC⁴ und der Basij⁵ schafft eine dauerhafte Atmosphäre der Angst
Diese Politik hat nicht zu mehr »Sicherheit« geführt, sondern die Unruhen angefacht und Kurdistan zu einem Zentrum des Protests gemacht.
Die Proteste 2022-2023 – Ein Meilenstein in den kurdischen Kämpfen
Der Tod von Jina (Mahsa) Amini, einer kurdischen Frau aus Saqqez, löste einen landesweiten Aufstand mit vielen Demonstrationen aus.
– Der kurdische Slogan »Jin, Jiyan, Azadî« (Frau, Leben, Freiheit) wurde zu einem nationalen Symbol.
– Die Repression war beispiellos: Internetsperren und gezielte Schüsse auf Demonstrant:innen in Städten wie Sanandaj, Mahabad und Bukan zeigten ungeschminkt die Bereitschaft des Regimes, brutale Gewalt anzuwenden.
– Ethnienübergreifende Solidarität: Die Proteste haben gezeigt, dass die kurdische Frage nicht mehr isoliert, sondern Teil eines umfassenderen Kampfes für Freiheit und Gleichheit im Iran ist.
Das Regime reagierte nicht mit Reformen, sondern mit Schauprozessen und Hinrichtungen (z. B. die Hinrichtung von Hamid Hosseinnejad Heidaranlou). Das heizte die öffentliche Wut weiter an.
Ungewisse Zukunft: Stillstand oder Explosion?
Szenarien für Ostkurdistan:
a) Beibehaltung des Status quo: Eskalation der Krise
– Anhaltende Repression könnte einen erneuten Konflikt mit Parteien wie der PJAK⁶ auslösen.
– Die Abwanderung kurdischer Eliten ins Ausland könnte eine besser organisierte Opposition in der Diaspora stärken.
b) Politischer Wandel: Ist eine Reform möglich?
– Eine leichte Entspannung könnte eintreten, wenn der Druck von außen nachlässt, aber die Erfahrung aus der Vergangenheit zeigt, dass das Regime sein »Widerstandsnarrativ« kaum aufgeben wird – was mehr Repression und Schweigen bedeutet.
– Strukturelle Veränderungen (z. B. Föderalismus oder kulturelle Autonomie) sind nahezu unmöglich. Das Regime setzt sie mit Separatismus gleich und betrachtet politische Offenheit als Zeichen der Schwäche.
c) Drittes Szenario: soziale Explosion
– Anhaltender wirtschaftlicher Druck und politische Unterdrückung könnten Kurdistan zum Zentrum eines breit aufgestellten Aufstandes für ethnische Rechte und für einen Regimewechsel machen. Angesichts der Präsenz organisierter Parteien wie der PJAK – der wohl am besten strukturierten Opposition zum Regime – ist dieses Szenario alles andere als unwahrscheinlich.
Schlussfolgerung
Die Islamische Republik hat bisher keine Bereitschaft gezeigt, ihr Verhältnis zu den unterdrückten Nationalitäten des Irans neu zu definieren. Veränderungen werden nicht nur vom Ergebnis der Gespräche zwischen dem Iran und den USA abhängen, sondern auch von der innenpolitischen Machtdynamik und dem internationalen Druck. Die Zukunft des Irans als multinationaler Staat hängt vom Übergang von einem »sicherheitsreligiösen Modell« zu einer dezentralisierten Demokratie ab – ein Weg, der nach wie vor voller Unwägbarkeiten ist.
¹ Dieser Artikel wurde geschrieben, bevor die Bombardierungen Irans durch die Luftwaffe Israels begannen und die Situation im Mittleren Osten eskalierten.
² Die kurdische Befreiungsbewegung definiert Nation gesellschaftlich und setzt sie nicht mit dem Staat gleich
³ Gegründet 1946, bestand die Mahabad-Republik 11 Monate im Nordwesten des Iran.
⁴ Das IRGC (Korps der Islamischen Revolutionsgarden) ist eine Eliteeinheit des iranischen Militärs, die nach der Revolution von 1979 gegründet wurde, um die Islamische Republik zu schützen und ihre Ideologie durchzusetzen. Es operiert unabhängig von der regulären Armee und verfügt über erheblichen politischen und wirtschaftlichen Einfluss.
⁵ Die Basij sind eine freiwillige paramilitärische Truppe unter dem IRGC, die für Aufgaben der inneren Sicherheit übernimmt z.B. die Unterdrückung von Protesten und die Überwachung der ideologischen Loyalität
⁶ Partei für ein freies Leben in Kurdistan – Oppositionspartei