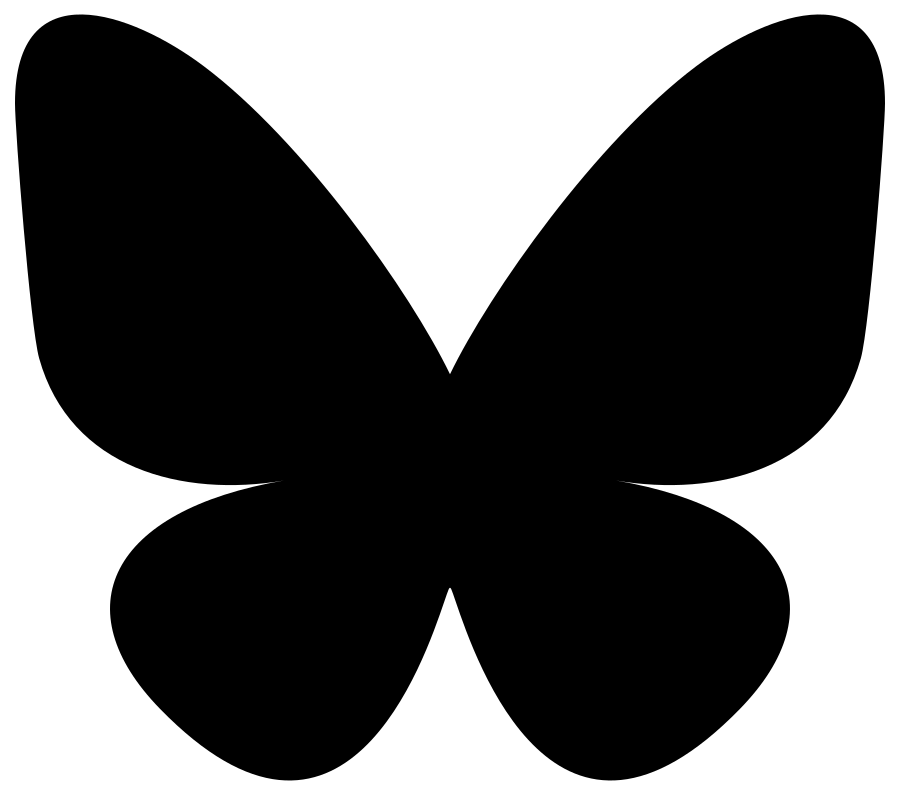Das İmralı-Gefängnis im nationalen und internationalen Rechtssystem
Rezan Sarıca, Rechtsanwalt
Rezan Sarıca, Rechtsanwalt
In diesem Artikel wird die frühere und gegenwärtige rechtliche Situation von Abdullah Öcalan, der am 15. Februar 1999 aus der griechischen Botschaft in Kenia entführt und an die Türkei übergeben wurde, thematisiert. Es wird versucht, die Verwaltungsform des İmralı-Gefängnisses, in dem er seit etwa 26 Jahren in verschärfter lebenslanger Isolationshaft festgehalten wird, sowie die während dieser Zeit erlittenen Foltermethoden zu erläutern. Außerdem wird auf die Entwicklungen nach dem Urteil »Öcalan Nr. 2« des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) vom 18. März 2014 im Zusammenhang mit dem sogenannten »Recht auf Hoffnung« eingegangen und der aktuelle Stand beleuchtet.
Die Inhaftierung politischer Gefangener wurde von souveränen Staaten und Systemen niemals ausschließlich wegen des Freiheitsentzuges betrieben. Es geht im Wesentlichen darum, das Leben der Gefangenen während ihrer Haftzeit zu einer Qual zu machen, ihren Willen zu brechen, sie umzuformen und zur Unterwerfung zu zwingen. Diese Haftanstalten, deren Bauweise sowie die geschriebenen und ungeschriebenen Regeln dieser Einrichtungen sind entsprechend darauf ausgerichtet.
Das İmralı-Gefängnis, in dem Öcalan festgehalten wird, nimmt in der internationalen Ordnung eine besondere Stellung ein. Dieses Gefängnis, in das er im Rahmen einer internationalen Operation unter Beteiligung vor allem europäischer Staaten gebracht wurde, wird von einer rechtswidrigen Denkweise geprägt. Im Jahr 1999 wurden grundlegende Schutzmechanismen, die in den Genfer Konventionen der Vereinten Nationen, im nationalen Recht und im Asylrecht verankert sind, für Öcalan außer Kraft gesetzt. Obwohl es sich um eine völkerrechtswidrige Entführung handelte, berücksichtigte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) mit seinem Urteil »Öcalan Nr. 1« von 2003 die Zeit vor seiner Inhaftierung auf İmralı in keiner Weise und legitimierte damit die illegale internationale Entführung.
Ein weiterer wichtiger Punkt dieses EGMR-Urteils betrifft das im Mai/Juni 1999 verhängte Todesurteil gegen Öcalan, das nach einem Scheinprozess ergangen war. Der EGMR stellte fest, dass Öcalans Recht auf ein faires Verfahren verletzt worden ist, und forderte eine Wiederaufnahme des Verfahrens. Doch eine faire Neuverhandlung wurde nie durchgeführt. Der Ministerrat des Europarats, der für die Überwachung der Umsetzung von EGMR-Urteilen zuständig ist, kam seiner Verantwortung nicht nach und sorgte stattdessen dafür, dass der Fall geschlossen wird, ohne dass die erforderlichen Maßnahmen ergriffen wurden.
Das Regime der verschärften lebenslangen Isolationshaft
Mit der im Jahr 2002 eingeführten gesetzlichen Änderung Nr. 4771 wurde in der Türkei die Todesstrafe in verschärfte lebenslange Haftstrafe umgewandelt und die Vollstreckung der verschärften lebenslangen Haftstrafen für Verbrechen gegen den Staat auf Lebenszeit festgelegt. Mit anderen Worten: Die Verurteilten bleiben bis zu ihrem Tod im Gefängnis.
Zusätzlich wurden die Grundrechte und Freiheiten der Gefangenen während der Haftzeit äußerst eingeschränkt definiert. Gemäß Artikel 25 des Strafvollzugsgesetzes Nr. 5275 der Türkei unterliegen Personen, die zu verschärfter lebenslanger Haft verurteilt sind, Beschränkungen, wie der Unterbringung in Einzelzellen und dem Recht, täglich nur eine Stunde an die frische Luft zu gehen. Sie haben zudem nicht das Recht, von drei Personen außerhalb ihres Verwandtenkreises Besuche zu empfangen – ein Recht, das anderen Gefangenen zusteht.
Dieser Zustand wird in den Berichten des Europäischen Komitees zur Verhütung von Folter (CPT) als Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot gewertet und es wird darauf hingewiesen, dass das Regime im Einklang mit grundlegenden Prinzipien umfassend überarbeitet werden sollte.
Ausnahmesituation bei Besuchen und ein einzigartiges Beispiel für begrenzte Kommunikation mit der Außenwelt
Willkürliche administrative Verfahren wurden eingeführt, die die Umsetzung der ohnehin eingeschränkten Rechte weiter behinderten. Familienangehörige konnten ihre inhaftierten Verwandten nie regelmäßig besuchen. Obwohl Öcalan zustand, sich jederzeit mit seinen Anwälten zu treffen (Strafvollzugsgesetz der Türkei, Art. 59), wurde dieses Recht auf eine Stunde pro Woche beschränkt. Doch selbst diese Regelung wurde nicht konsequent umgesetzt.
Nach geltendem Recht ist das İmralı-Gefängnis eine dem Justizministerium unterstellte Hochsicherheitsanstalt vom Typ F und sollte gemäß nationalen und internationalen Vorschriften betrieben werden. Das aktuelle System in İmralı ist jedoch als Isolationssystem konzipiert und wird durch umfassende Isolationstechniken verwaltet. Wie im Fall von Guantanamo erfordert ein solcher Ausnahmezustand im juristischen Sinne eine gesetzliche Grundlage oder eine gültige Entscheidung, die das von internationalen Standards abweichende Regime rechtfertigt. Obwohl eine solche Grundlage fehlt, kommen die Bedingungen İmralıs denen eines Ausnahmezustands gleich.
Selbst die ohnehin schon eingeschränkten Rechte wurden weiter beschnitten. Seit dem 27. Juli 2011 konnte Öcalan seine Anwälte lediglich fünf mal treffen. Die anderen auf İmralı inhaftierten Personen – Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım und Veysi Aktaş – konnten ihre Anwälte bisher überhaupt nicht treffen. Herr Aktaş hat am 28. April 2024 seine 30-jährige Haftzeit vollendet. Obwohl er gemäß Gesetz zu diesem Zeitpunkt hätte entlassen werden müssen, wurde seine Freilassung rechtswidrig verhindert und die Überprüfung seines Falls um ein weiteres Jahr verschoben.
Seit dem 6. Oktober 2014 hatte Öcalan innerhalb von zehn Jahren nur sechs Familienbegegnungen. Den anderen Gefangenen wurden in demselben Zeitraum nur drei Familientreffen gestattet. Telefongespräche mit Familienmitgliedern fanden insgesamt nur zweimal statt. Auch wurde ihnen verwehrt, per Brief mit ihren Familien und Anwälten zu kommunizieren.Selbst außergewöhnliche Ereignisse wie Erdbeben, Brände oder Todesfälle in der Familie führten nicht zu einer Lockerung des strengen Isolationsregimes. Die gesetzlichen Bestimmungen, die beispielsweise im Todesfall von Familienangehörigen das Recht auf ein Telefongespräch vorsehen, wurden ebenfalls nicht eingehalten.
Disziplinarstrafen, Anwaltsverbote und Verstöße gegen das Recht auf Verteidigung
Bereits zuvor verhinderte Anwaltsbesuche wurden 2016 durch einen Beschluss des Strafvollzugsgerichts offiziell verboten. Während des Ausnahmezustands wurden alle Rechte (Recht auf einen Anwalt, Familienbesuche, Briefe, Telefonate und jegliche Kommunikationsmittel) vollständig außer Kraft gesetzt. Ein solches Vorgehen und Verfahren war weder in der bestehenden verfassungsrechtlichen Ordnung noch im Ausnahmezustandsrecht vorgesehen. Dies wurde durch einen Gerichtsentscheid umgesetzt – ohne jegliche rechtliche Grundlage.
Ab 2018 wurden auch Familienbesuche wegen Disziplinarstrafen verboten, die alle drei Monate neu verhängt wurden. Bis heute wurden mindestens 24 Disziplinarstrafen erteilt. Rechtsanwälten wurde wie seit 2016 üblich alle sechs Monate durch mehr als zehn Beschlüsse des Strafvollzugsgerichts der Kontakt zu ihrem Mandaten verwehrt. Diese Strafen und Verbote wurden in einer kontinuierlichen Abfolge beschlossen.
In dem am 5. August 2020 veröffentlichten Bericht des CPT über den Besuch des İmralı-Gefängnisses vom 6. bis 17. Mai 2019 wurde festgestellt: »Nach dem Ende des Ausnahmezustands äußert das CPT große Besorgnis darüber, dass allen Gefangenen der Besuch durch ihre Anwälte und Familienmitglieder verweigert wird. (…) In Bezug auf die Familienbesuche scheint die offizielle Begründung für die Ablehnung der Besuche äußerst irreführend zu sein.«
Während Anwälte einen wichtigen Schutz gegen Folter darstellen, wurden alle Verfahren im Zusammenhang mit Disziplinarstrafen und Anwaltsverboten geheim durchgeführt. In der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) »Öcalan No. 2« erinnerte Richter Pinto de Albuquerque an folgende bedeutende Anmerkung:
»Anwälte sind in Ermittlungs- und Verfahrensphasen von äußerster Wichtigkeit, doch während der Vollstreckung einer Strafe nimmt diese Bedeutung noch zu. Der Zugang zu einem Anwalt während der Strafvollstreckung ist unerlässlich, da dieser unabhängig überprüfen kann, ob das angewandte Gefängnisregime, verhängte Disziplinarstrafen, spezielle Zwangsmaßnahmen, besondere Sicherheitsmaßnahmen sowie sämtliche Verbote, Einschränkungen und Verpflichtungen, die mit der Situation des Inhaftierten zusammenhängen, rechtmäßig sind. Falls erforderlich, kann er Maßnahmen ergreifen, um die grundlegenden Rechte des Inhaftierten wiederherzustellen. Der Anwalt ist während der Strafvollstreckung der unverzichtbare Hüter der Menschenrechte.«
Doch weder vor Gericht noch bei den Disziplinarausschüssen konnten die Anwälte Einsprüche einlegen. Das Recht auf Zugang zu Gerichten wurde behindert, während die Richter und Gerichte entweder auf Anträge, denen sie sich nicht hätten entziehen dürfen, nicht reagierten oder Entscheidungen trafen, die über die Grenzen des Gesetzes hinausgingen.
Obwohl Anwälte das Recht und die Befugnis haben, auf Akten zuzugreifen, ist es speziell im Fall İmralı unmöglich, Akten einzusehen, sie zu prüfen oder Kopien von Akten und Beweisen zu erhalten. Nach Artikel 13 der Verfassung der Türkei kann ein Recht nur durch ein Gesetz eingeschränkt werden. Ebenso schreibt Artikel 139 der Verfassung vor, dass die Justizorgane verpflichtet sind, im Einklang mit der Verfassung, den Gesetzen und dem Recht zu handeln.
Auf İmralı jedoch behalten Gerichte Akten aus willkürlichen und politischen Gründen geheim, ohne sich auf ein Gesetz zu stützen und lehnen etwaige Anträge ab. Als Begründung wird beispielsweise angeführt, dass Entscheidungen an die Presse weitergegeben wurden. Eine solche Begründung findet sich jedoch in keinem Gesetz der Türkei. Diese Entscheidungen belegen damit, dass die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Richter verloren gegangen ist. Zugleich stellen sie einen klaren Hinweis auf ein Dienstvergehen dar.
Daher kann das Recht auf Berufung oder Widerspruch bei höheren Instanzen im Rahmen des Verteidigungsrechts nicht effektiv ausgeübt werden. Auf İmralı gibt es weder die Möglichkeit, Gespräche zu führen, noch besteht vor Gericht Raum für Nachforschungen, Untersuchungen oder Prüfungen. Rechtsicherheit ist dadurch nicht gegeben.
Ineffektive Mechanismen
Im Jahr 2011, als zu den ohnehin schlechten Haftbedingungen noch Anwaltsverbote hinzukamen, wurde im Oktober im Namen von Öcalan eine individuelle Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) eingereicht. Acht Jahre lang unternahm der EGMR keine Schritte, bevor er die Beschwerde 2019 an die türkische Regierung weiterleitete. Obwohl die türkische Regierung im Jahr 2020 eine Antwort mitsamt Gegenargumenten dem EGMR überliefert hat, hat der EGMR seit 4 Jahren – insgesamt also seit 13 Jahren – keine weitere Entscheidung getroffen.
Während systematisch gegen Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens), Artikel 3 (Verbot der Folter) und Artikel 6 (Recht auf Verteidigung) verstoßen wird, zeigt der passive, verzögernde Ansatz des EGMR keine Übereinstimmung mit internationalen Standards. Statt einer effektiven und ergebnisorientierten Überprüfung der Haftzustände wird auf İmralı eine einzigartige Willkür und unmenschliche Behandlung geduldet. Nationale und internationale Vorschriften sind auf İmralı außer Kraft gesetzt, und die Haltung des EGMR spiegelt die internationale Haltung gegenüber der Entführung 1999 wider.
Seit 2013 wurden über 80 Beschwerden beim türkischen Verfassungsgericht (AYM – Anayasa Mahkemesi) eingereicht, die sich auf Misshandlungen, unmenschliche Haftbedingungen und Verletzungen des Kommunikationsrechts beziehen. Doch wie andere Strukturen zieht auch das AYM die Verfahren über Jahre hinweg in die Länge und verliert dadurch an Wirksamkeit. Es zeigt die Tendenz, keine Entscheidungen zu wichtigen Beschwerden wie »Recht auf Hoffnung«, »Ausnahmezustandspraktiken«, »fehlende Information« oder »Isolationshaft« zu fällen.
Das CPT hat İmralı bisher neunmal besucht, zuletzt im September 2022, doch der Beobachtungsbericht wurde, obwohl er der Türkei vorliegt, bisher nicht veröffentlicht, die Veröffentlichung des Berichts sei von der Zustimmung der Türkei abhängig.
In seinen veröffentlichten Berichten hat das CPT darauf hingewiesen, dass das Verbot von Familien- und Anwaltsbesuchen besorgniserregend ist. Es betonte, den diskriminierenden Charakter der Vollstreckungsbedingungen der verschärften lebenslangen Freiheitsstrafe und empfahl Verbesserungen bei den Besuchsrechten. Doch fast keine der seit 2010 über einen Zeitraum von 10 bis 14 Jahren gemachten Feststellungen und Empfehlungen wurden je umgesetzt. Stattdessen haben sich die Bedingungen auf İmralı kontinuierlich verschlechtert und die Rechtsverletzungen wurden systematisch fortgeführt.
Dies führte dazu, dass Öcalan und andere auf der Gefängnisinsel İmralı in eine Phase absoluter Kommunikationslosigkeit, wie etwa 43 Monate ohne jegliche Nachricht, gerieten. Dabei hätte das CPT die Macht internationalen öffentlichen Drucks auf die Türkei ausüben können. Nach Artikel 10 Absatz 2 seines Gründungsdokumentes hätte CPT den Beschluss fassen können, die Berichte ohne Zustimmung der Türkei zu veröffentlichen, um die Öffentlichkeit zu informieren. Neben der Aufgabe, Verstöße zu dokumentieren, trägt das CPT auch die Verantwortung, Folter zu verhindern – wenn nötig, auch mit öffentlichem Druck.
Stattdessen hielt das CPT an der Haltung fest, İmralı als ein »normales« Gefängnis zu betrachten. Auch der Europarat beschränkte sich darauf, die Geschehnisse lediglich zu beobachten.
Die Phase der Kommunikationslosigkeit und die Öcalan-Frage bei den Vereinten Nationen
Seit dem 25. März 2021 gab es über einen Zeitraum von 43 Monaten keinerlei Nachricht von Öcalan und den anderen Gefangenen. In seinem letzten Telefonat mit seinem Bruder äußerte Öcalan: »Das Recht muss angewandt werden. Rechtlich gesehen müssten die Anwälte nach İmralı kommen dürfen. Das erfordert das Gesetz.« Er prangerte damit die Rechtswidrigkeit der Situation an. Danach wurde jedoch jeglicher Kontakt zur Außenwelt abgebrochen und alle Kommunikationsmöglichkeiten sowie Rechte wurden vollständig aufgehoben.
Trotz der Nutzung aller innerstaatlichen Rechtsmittel war es nicht möglich, Kontakt zu Öcalan aufzunehmen. Solche langen Phasen der Kommunikationslosigkeit gelten gemäß den Rechtsprechungen der Vereinten Nationen als die unsicherste, schutzloseste und unabsehbarste Zeitperiode und weisen Parallelen zu Praktiken des »Verschwindenlassens« und der »Willkür« auf. Aus diesem Grund reichten seine Anwälte eine Beschwerde beim Menschenrechtsausschuss der Vereinten Nationen (UNHRC) ein.
Infolge dieser Beschwerde erließ der Ausschuss am 6. September 2022 eine dringliche Maßnahmenentscheidung und forderte, dass Öcalan »unverzüglich und ohne jegliche Einschränkungen« seine Anwälte treffen dürfe. Obwohl der Ausschuss diese Entscheidung am 19. Januar 2023 erneut der türkischen Regierung vorlegte, wurden bis heute keine Schritte zur Umsetzung unternommen. Seit dem letzten Treffen mit seinen Anwälten am 7. August 2019 dauern die Verbote von Anwaltsbesuchen an.
Auf der Suche nach einer Lösung für die Isolation auf İmralı nahmen wir vom 14. bis 18. Juli 2024 am 80. Treffen des UN-Ausschusses gegen Folter (UNCAT) teil, bei dem die Isolationspraktiken gegenüber Öcalan und das »Recht auf Hoffnung« drei Tage lang im Mittelpunkt der Sitzung standen. Die Berichte zu den Isolationsmaßnahmen wurden auf der Website des UNCAT veröffentlicht. In Gesprächen mit den Berichterstattern wurden die realen Umstände auf İmralı als äußerst besorgniserregend eingestuft.
Die Berichterstatter richteten zahlreiche Fragen direkt an türkische Regierungsvertreter, unter anderem zu Isolation und Besuchsverboten, dem fehlenden Zugang von Anwälten zu Akten, der Häufung von Disziplinarstrafen, der Geheimhaltung dieser Prozesse gegenüber Anwälten, der absoluten Kommunikationslosigkeit seit dem 25. März 2021 sowie der Nichteinhaltung internationaler Standards bei lebenslangen Haftstrafen. Es wurde gefragt: »Was für Maßnahmen müssen ergriffen werden, damit sich die Haftbedingungen verbessern, der Kontakt zur Außenwelt zunimmt und die Möglichkeit einer bedingten Entlassung entsteht?«
Während der Sitzungen, an denen auch Menschenrechtsexperten teilnahmen, erwarteten die Berichterstatter überzeugende und begründete Erklärungen zu den Maßnahmen. Die Regierungsvertreter konnten jedoch außer der Aufzählung einiger Gesetzesartikel weder die Schärfe der Isolation begründen noch rechtfertigen oder verteidigen.
Eine Woche nach den Sitzungen veröffentlichte der UNCAT einen vorläufigen Beobachtungsbericht. Darin wurde empfohlen, die besorgniserregenden Isolationsbedingungen gesetzeskonform zu gestalten und Besuchsrechte, insbesondere für Anwälte, zu ermöglichen, um das Verteidigungsrecht und den Schutz vor Folter zu gewährleisten und rechtliche Änderungen für das »Recht auf Hoffnung« vorzunehmen. Die Berichterstatter kündigten an, die Umsetzung dieser Empfehlungen bis zur nächsten Überprüfung im September 2025 zu verfolgen.
Die Isolation setzt sich fort!
Nach all diesen Entwicklungen wurde ein Familienbesuch am 23. Oktober 2024 bei Herrn Öcalan genehmigt: sein Neffe Ömer Öcalan, der auch Parlamentsabgeordneter der DEM ist, konnte ihn besuchen. Durch dieses Treffen gab es nach 43 Monaten erstmals wieder ein Lebenszeichen Öcalans! Jedoch, wie auch in den Medien berichtet, erklärte Öcalan in diesem Gespräch: »Die Isolation dauert immer noch an«. Das in diesem Text dargestellte System der Isolation setzt sich also in allen Aspekten fort.
Das Recht auf Hoffnung und die Freiheit
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) befand, dass die lebenslange Freiheitsstrafe für Öcalan, die eine dauerhafte verschärfte Inhaftierung vorsieht, gegen das Verbot von Folter verstößt. Am 18. März 2014 entschied der EGMR in seinem Urteil »Öcalan No. 2«, dass Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) verletzt wurde. Ein ähnliches Urteil war bereits im Fall Vinter vs. Vereinigtes Königreich von 2013 gefällt worden. Es folgten drei weitere Urteile die Türkei betreffend, die die gleiche rechtliche Linie formulierten. Der EGMR entschied, dass Artikel 47 des türkischen Strafgesetzbuchs, Artikel 25 des Vollstreckungsgesetzes, Artikel 107/16 des Vollstreckungsgesetzes und Artikel 17/4 des Gesetzes Nr. 3713, mit dem das Recht auf bedingte Entlassung abgeschafft wurde, rechtswidrig seien.
Der EGMR erklärte außerdem, dass die türkischen Gesetze, die unter anderem die lebenslange Haftstrafe ohne jegliche Möglichkeit auf Strafmilderung oder eine vorzeitige Entlassung vorsehen, geändert werden müssen. Eine lebenslange Haftstrafe darf nicht dazu führen, dass eine Person nie wieder und unter keinen Umständen aus dem Gefängnis entlassen wird oder sich nicht mit der Gesellschaft wieder vereinen kann. Der Betroffene muss die Hoffnung auf ein zukünftiges Wiedersehen mit der Gesellschaft und die Möglichkeit einer Überprüfung seiner Haftbedingungen nach einer bestimmten Zeit behalten. Dies muss transparent und nach klaren Kriterien erfolgen. Eine Person muss dieses Recht haben und wissen, dass nach einer bestimmten Strafverbüßungszeit ihre Situation erneut überprüft wird, auf welcher Grundlage diese Überprüfung stattfinden wird, wann die nächste Beurteilung erfolgen wird, wer diese Beurteilung nach welchen Regeln vornehmen wird und dass ein Rechtsweg gegen die Entscheidungen besteht. Die Möglichkeit der Entlassung und somit das »Recht auf Hoffnung« muss sowohl de jure (rechtlich) als auch de facto (tatsächlich) gegeben sein.
Im November 2021 nahm das Komitee zum ersten Mal das »Recht auf Hoffnung« auf die Tagesordnung und stellte fest, dass die Türkei das Urteil des EGMR immer noch nicht umgesetzt hat. Es forderte die Türkei auf, sofort gesetzliche Änderungen vorzunehmen, um den Anforderungen des EGMR zu entsprechen. Leider wurde dieser Aufruf nicht beachtet, und die türkische Regierung hat bis heute keine substanziellen Änderungen vorgenommen.
Das Komitee stellte bei einem erneuten Treffen im September 2024 fest, dass die Türkei weiterhin die Entscheidungen des EGMR und des Ministerkomitees nicht umsetzt. Der Status der lebenslangen verschärften Haft ohne Möglichkeit auf eine Haftprüfung bleibt unverändert, was weiterhin große Besorgnis erregt. Es wurde erneut gefordert, dass die verschärfte lebenslange Haft unverzüglich geändert wird, um der internationalen Rechtsprechung gerecht zu werden. Sollte es bis zur Sitzung im September 2025 keine wesentlichen Fortschritte geben, will das Komitee den Fall erneut aufgreifen und weitere Schritte einleiten. In der folgenden Erklärung des Komitees hieß es: »Falls bis zu diesem Zeitpunkt kein konkreter Fortschritt erzielt wird, der eine positivere Bewertung ermöglicht, wird das Sekretariat angewiesen, einen Entwurf für einen Zwischenbeschluss vorzubereiten.«
Die verzögerte und ineffektive Herangehensweise des Komitees wird zunehmend als wirkungslos angesehen. Dieser Ansatz und die damit verbundene Unklarheit verhindern, dass die Türkei das Komitee als ernstzunehmenden Mechanismus wahrnimmt. Darüber hinaus steht der Ansatz des Komitees nicht im Einklang mit dem Geist der Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR). Die 26-jährige Haft auf İmralı und deren unbestimmte Verlängerung beseitigen die Möglichkeit eines »Rechts auf Hoffnung« und verschärfen die Verletzung des Folterverbots. Im Urteil »Öcalan Nr. 2« stellte der EGMR fest, dass »… der Verstoß gegen Artikel 3 nicht in der späteren Phase der Inhaftierung, sondern zum Zeitpunkt der Verhängung der lebenslangen Freiheitsstrafe entsteht.« Mit anderen Worten: Das Folterverbot wird seit 2002 offiziell verletzt. Die mangelnde Entschlossenheit der Türkei, sich an die internationalen Menschenrechtsstandards zu halten, stellt ein ernstes Problem dar, das der Europarat und das Komitee dringend ansprechen müssen.
Aus diesem Grund sollte der Überwachungsprozess zur Umsetzung der Entscheidung unverzüglich auch von der Parlamentarischen Versammlung des Europarats unterstützt werden. Es ist notwendig, dass das Komitee in seinen gerichtlichen oder diplomatischen Prozessen eine politische Perspektive entwickelt, und ergänzende Verfahren eingerichtet werden, die eine Brücke zwischen dem Europarat und dem Komitee schlagen. Angesichts der derzeitigen Lage sollte das Komitee auch in Erwägung ziehen, die Meinung des EGMR gemäß Artikel 46 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) einzuholen. Dies muss selbstverständlich unbedingt und unverzüglich umgesetzt werden.
Die Freiheit, die den Kern der Angelegenheit bildet, kann nur unter diesen Voraussetzungen auf einer rechtlichen Grundlage möglich, vertrauenswürdig und absehbar werden.
Die von der kurdischen Bevölkerung sowie in Europa und dem Nahen Osten geführte Kampagne für die Freiheit von Herrn Öcalan zeigt, dass die Zeit für seine Freilassung gekommen ist. Die wichtigsten Gründe für seine Freilassung sind, dass er, obwohl er seit etwa 26 Jahren unter Bedingungen der Folter inhaftiert ist, in dieser Zeit und schon zuvor kontinuierlich ernsthafte Bemühungen, Initiativen und Kampagnen für eine demokratische Lösung der kurdischen Frage unternommen hat, ihm eine Rolle als Vermittler für Frieden und demokratische Lösungen zugeschrieben wird und er sich für die Etablierung demokratischer Prinzipien und Strukturen insbesondere im Nahen Osten, aber auch weltweit einsetzt. Diese Gründe spiegeln die grundlegenden historischen und demokratischen Bedürfnisse der Gesellschaft wider.
Das Recht auf Hoffnung – das Recht auf Freiheit – sollte im Kontext dieser Notwendigkeiten und Bedürfnisse diskutiert werden. Ohne weiteren Zeitverlust sollten konkrete Schritte in Richtung Freiheit unternommen werden, um eine demokratische Ordnung zu verwirklichen.
Es ist an der Zeit, dass die internationale Gemeinschaft, einschließlich des Europäischen Parlaments und des Ministerkomitees des Europarats, endlich die nötigen Maßnahmen ergreift, um den erforderlichen rechtlichen Rahmen für Öcalans Freiheit zu schaffen.