Über die Entwicklung von bewaffneten Propagandaeinheiten hin zu einer professionellen Guerilla-Armee
Der 15. August – Der Beginn des bewaffneten Kampfes
Michael Kaiser, Mitglied der Initiative »Defend Kurdistan«
»AN DAS PATRIOTISCHE VOLK KURDISTANS
Der barbarische türkische Kolonialismus, der mit dem faschistischen Militärputsch vom 12. September einen faschistischen Charakter annahm, begann nun, seine Unterdrückungs- und Repressionspolitik mit den grausamsten Methoden und in den größten Ausmaßen fortzusetzen. Er erklärte unser gesamtes Land zum Militärgebiet und begann unser Land von Dorf zu Dorf, von Stadtteil zu Stadtteil erneut zu okkupieren. Unsere Menschen wurden ohne Verhöre und ohne Gerichtsverfahren einfach erschossen, aufgehängt, erdrosselt, angezündet; zu hunderttausenden gefoltert und in die Gefängnisse gesteckt. Er versucht, mit unseren nationalen Werten und unserer Menschenwürde zu spielen. Diese ganze Grausamkeit betreibt er auch gegen das werktätige türkische Volk.«
Mit diesen Worten eingeleitet wird das Proklamationsflugblatt der »Befreiungskräfte Kurdistans« (ku. Hêzên Rizgariya Kurdistan, HRK), das am 15. August 1984 verteilt wurde, kurz nachdem bewaffnete Kräfte gleichzeitig in fast 40 Städte und Dörfer sowie zwei Kreisstädte der Türkei eingedrungen waren und den bewaffneten Kampf für ein freies Kurdistan aufgenommen hatten. Der damals begonnene Kampf dauert nun schon 39 Jahre an und hat sich im Laufe der Jahrzehnte stark verändert. Was führte zum Beginn des bewaffneten nationalen Befreiungskampfes? Wie hat er sich entwickelt? Wo steht er heute, insbesondere vor dem Hintergrund der gerade stattgefundenen Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in der Türkei? Anlässlich des Jahrestages möchte ich versuchen, mögliche Antworten auf diese Fragen zu formulieren.
Mesopotamien, das Zweistromland, in dem sich die erste Revolution der Menschheitsgeschichte – die neolithische Revolution – vollzog, hat eine wechselvolle Geschichte. Lange Zeit war es das Zentrum der menschlichen Zivilisation und bis heute ist die Region um Mesopotamien, die wir als historisches Siedlungsgebiet der kurdischen Nation bezeichnen können, hart umkämpft. Es ist ein Kampf der Realitäten. Auf der einen Seite stehen jahrhundertealte, wenn nicht jahrtausendealte Interessenskonflikte zwischen imperialen und regionalen Mächten. So wurde Kurdistan nicht, wie viele glauben, zum ersten Mal im Vertrag von Lausanne1 oder im Vertrag von Sèvres2 aufgeteilt. Mit historischer Gewissheit können wir heute sagen, dass die erste bewusste Teilung des kurdischen Siedlungsgebietes im 17. Jahrhundert zwischen dem Osmanischen und dem Persischen Reich stattfand3. Auf der anderen Seite sehen wir einen jahrtausendelangen Widerstand der dort lebenden Menschen gegen die herrschenden staatlichen Kräfte. Gerade die Geschichte der kurdischen Nation ist von besonderem Interesse, da sie wie kaum eine andere Nation der Welt von historisch gewachsenen dialektischen Widersprüchen geprägt ist. Es gibt nur wenige Regionen auf der Welt, in denen so viele Aufstände stattgefunden haben. Gleichzeitig gibt es nur wenige Regionen, in denen so viele Massaker und Völkermorde stattgefunden haben. Es gibt wenige Orte, an denen eine so lebendige Hoffnung bei gleichzeitig scheinbar unüberwindbarer Resignation herrscht wie in Kurdistan. Es gibt wenige Nationen, in denen die Sehnsucht nach Freiheit so eng mit der extremen Bereitschaft zur Kollaboration verbunden ist wie in Kurdistan.
Es ist eine vielfältige und sehr wechselvolle Geschichte, die ihren letzten absoluten Höhepunkt im 20. Jahrhundert hatte. Verbal und formal waren die Kurdinnen und Kurden vor allem in der neu gegründeten Republik Türkei bereits von der Bildfläche verschwunden. Im offiziellen Sprachgebrauch hieß ihr Gebiet »Ostanatolien« und ihr Volk »Bergtürken«, die kurdische Sprache war verboten. Mustafa Kemal, heute unter dem Namen Atatürk (Vater der Türken) bekannt, hatte zunächst Seite an Seite mit der kurdischen Gesellschaft gekämpft, um seinen Traum von einer Republik zu verwirklichen. Doch kaum war dies gelungen, wandte er sich gegen sie. Kurz nach der Revolution sagte er: »Es gibt in der Türkei eine Nation und zwar die türkische. Diejenigen, die sich nicht dazu bekennen, haben nur ein Recht. Nämlich der türkischen Nation zu dienen.« Dieser scheinbare Fluch lastete auf der kurdischen Gesellschaft, die ihrerseits durch immer neue Aufstände dafür sorgte, nicht in Vergessenheit zu geraten. Vor allem ab Mitte des 20. Jahrhunderts schien es jedoch immer stiller um sie zu werden. Eine Grabesstille, die vor allem bis zum Aufflammen der 68er-Bewegung anhielt.
»Kurdistan ist eine Kolonie«
Überall auf der Welt inspirierten sich junge Menschen gegenseitig und begehrten gegen die herrschende Klasse auf. Es war die Zeit, in der weltweit nationale Befreiungsbewegungen den Kampf aufnahmen. Selbst im Herzen der kapitalistischen Moderne bildeten sich bewaffnete Strukturen, die sich gegen den Imperialismus und für eine befreite Welt einsetzten. Es war auch die Zeit, in der für die meisten Menschen zumeist unterbewusst klar wurde, dass die Sowjetunion zu scheitern begann und sie sich auf die Suche nach neuen Perspektiven machten. Eine Zeit, die natürlich auch an der Türkei und Kurdistan nicht spurlos vorbeigegangen ist. Es bildeten sich große Bewegungen, die sich einerseits an den Geschehnissen im globalen Kontext orientierten, andererseits aber auch eigene Wege gingen. So entstand aus einer anfangs kleinen Gruppe von Studierenden um Abdullah Öcalan die These, dass das damals von 300.000 Soldaten besetzte Kurdistan eine Kolonie sei. Eine These, die die revolutionäre Bewegung in der Türkei, den türkischen Staat und die kurdische Gesellschaft erschütterte. Aus der These wurde schnell eine Synthese von Theorie und Praxis und aus der Student:innengruppe eine Partei, die zur Befreiungsbewegung wurde.
Auf die zunehmende Schwächung des Staates und das Erstarken revolutionärer Kräfte in immer breiteren Gesellschaftsschichten reagierte das türkische Militär mit einer neuen Eskalationsstufe. Der Militärputsch vom 12. September 1980 ist heute allen ein Begriff, die sich auch nur ein wenig mit der Geschichte der Region beschäftigt haben. Hunderttausende mussten das Land verlassen, Zehntausende wurden in die berüchtigten Foltergefängnisse verschleppt, Tausende verloren ihr Leben. Doch das war nicht das Ende. Was folgte, war ein jahrelanger Widerstand gegen die Folter und das Leben in den Gefängnissen. Es hatte sich gezeigt, dass jede Form von Politik für die kurdische Gesellschaft zu einer Frage des Überlebens geworden war. Die kurdische Befreiungsbewegung beschloss, den bewaffneten Kampf vorzubereiten.
»Langfristiger Volkskrieg«
Wie viele andere internationalistische Bewegungen vor ihr gingen die ersten Kämpferinnen und Kämpfer in den Libanon, um sich von den Kräften des palästinensischen Freiheitskampfes zeigen zu lassen, wie ein solcher Kampf gestaltet werden könnte. Es dauerte lange, bis man sich entschied, mit welcher Strategie man in den Kampf ziehen wollte. Aber die Entscheidung fiel, und es kam zu dem oben beschriebenen ersten bewaffneten Angriff kurdischer bewaffneter Kräfte für ein freies Kurdistan. Unter Berufung auf die Methode des »langfristigen Volkskrieges« wurden die HRK gegründet, die zunächst vor allem in Form von bewaffneten Propagandaeinheiten gegen Großgrundbesitzer, Militärstützpunkte, staatliche Institutionen, Folterknechte und Kollaborateure kämpften. Die Bedeutung der politischen Aufklärungsarbeit in der Bevölkerung in Verbindung mit den bewaffneten Aktionen stand von Anfang an im Mittelpunkt. So waren 40 % der Menschen, die sich an den ersten Aktionen beteiligten, keine Kader:innen der HRK, sondern noch unbewaffnete Zivilist:innen aus der Gesellschaft. Auf Angriffe auf Militärbasen folgten nicht selten spontane Demonstrationen der bewaffneten Kräfte zusammen mit den Menschen der Stadt.
Schon damals war klar, dass das Narrativ »Kurden kämpfen gegen Türken«, das wir bis heute häufig in den westlichen Medien sehen, nicht zutrifft. Zum einen waren die HRK – ebenso wie die PKK – weder eine »rein« kurdische Kraft, noch richteten sich ihre Aktionen gegen die türkische Gesellschaft. Es war ein Kampf gegen die herrschende Klasse der Türkei, vor allem aber gegen die Kolonisatoren Kurdistans. Dass diese nicht nur in der Türkei saßen (und bis heute sitzen), ließe sich anhand der weitestgehend bekannten deutsch-türkischen Beziehungen leicht erläutern, doch soll hier ein anderes Beispiel genannt werden. Kurz nach den Angriffen war es NATO-General Rogers aus den USA, der die zerstörten Militärstützpunkte begutachtete und später an den ersten Strategien zum Aufbau einer Konterguerilla4 mitarbeitete. Der bewaffnete Kampf begann nicht nur gegen die zweitgrößte NATO-Armee, sondern gegen die NATO selbst.
Nach knapp einem Jahr veröffentlichten die bewaffneten Kräfte eine Bilanz des ersten Kampfjahres. Sie gaben an, dass es in dieser Zeit gelungen sei, eine 1000 km lange »Kriegslinie« von Şemzînan (tr. Şemdinli) bis Gever (Yüksekova) zu errichten. Das Gebiet umfasst folgende Städte: Colemêrg (Hakkari), Sêrt (Siirt), Bedlîs (Bitlis), Wan (Van), Mûş, Çewlîg (Bingöl), Amed (Diyarbakır), Elazîz (Elazığ), Riha (Urfa), Semsûr (Adiyaman), Qers (Kars), Agirî (Ağri) und Dersim (Tunceli). Eine niedrige dreistellige Zahl von Soldaten, Kommandeuren und Kollaborateuren war getötet worden, während 48 Mitglieder der HRK ihr Leben gelassen hatten. Sie machten auch darauf aufmerksam, dass die Spezialkriegsmethoden des türkischen Staates – angefangen vom Aufbau einer Konterguerilla über die Schaffung eines Dorfschützernetzes5 bis hin zur gezielten Vertreibung der Dorfbevölkerung – offensichtlich die Handschrift derer trugen, die bereits an der Bekämpfung bewaffneter nationaler Befreiungskräfte in Afrika und Lateinamerika beteiligt gewesen waren.
»Theorie der nationalen Befreiung«
Zu Newro6z 1985 wurde beschlossen, die HRK aufzulösen und in die neu gegründete »Nationale Befreiungsfront Kurdistans« (ku. Eniya Rizgariya Neteweyî ya Kurdistanê ERNK) zu überführen. Es wurde eine Theorie der nationalen Befreiung in drei strategischen Phasen veröffentlicht. Die Phasen wurden darin wie folgt definiert. Die erste »Phase der strategischen Verteidigung«, in der es vor allem darum ging, durch bewaffnete Propagandaeinheiten für Popularität zu sorgen und erste Organisationsmomente in der Bevölkerung zu schaffen. Die zweite »Phase der strategischen Ausgeglichenheit«, in der es darum ging, befreite Gebiete aufzubauen, eine Guerilla-Armee zu schaffen und einem Großteil der Bevölkerung Organisationsmöglichkeiten zu bieten, was durch die neu gegründete ERNK erreicht werden sollte. Schließlich die dritte »Phase des strategischen Angriffs« mit dem Ziel der Unabhängigkeit und Abspaltung Kurdistans als eigener Staat. Die letzte Phase war jedoch als Option vorgesehen, für den Fall, dass sich die revolutionäre Bewegung in der Türkei wider Erwarten bis dahin nicht organisieren konnte und man sich wider Erwarten nicht einvernehmlich auf die zukünftige Gestaltung der Region einigen konnte. Begleitet werden sollte diese Phase von einem internationalen Zusammenschluss der sozialistischen Befreiungsbewegungen weltweit, angelehnt an die globale Bewegung, die 1968 im Zuge des Widerstands gegen den Vietnamkrieg entstanden war. Im Mittelpunkt stand dabei der Aufbau eines unabhängigen, vereinigten und demokratischen kurdischen Staates nach sozialistischem Vorbild, wie es in der Gründungserklärung der ERNK hieß.
Die kurdische Guerilla war geboren und entwickelte sich rasch. Nach mehreren organisatorischen und strategischen Veränderungen wurde sie im Oktober 1986 erneut umbenannt in »Volksbefreiungsarmee Kurdistans« (ku. Artêşa Rizgariya Gelê Kurdistan, ARGK). Diesen Namen trug sie bis zum Jahr 2000, als sie zuletzt grundlegend umstrukturiert und in die bis heute bestehenden »Volksverteidigungskräfte« (ku. Hêzên Parastina Gel, HPG) überführt wurde. In der Zwischenzeit hatte die autonome Organisierung der Frauen in der Befreiungsbewegung massiv an Bedeutung gewonnen. Eigene Strukturen und eine eigene autonome Partei waren gegründet worden. In diesem Zusammenhang kam es schließlich 1995 auch zur Gründung der ersten kurdischen Frauenarmee unter dem Namen »Verband der freien Frauen Kurdistans« (Yeketiya Azadiya Jinên Kurdistan, YAJK).
»Verteidigung der Gesellschaft und ihrer Errungenschaften«
Die Rolle der Guerilla in der Befreiungsbewegung an sich hatte im Laufe der Jahre immer mehr an Bedeutung gewonnen, so dass es vor allem in den 90er Jahren Phasen gab, in denen sie die anderen Bereiche der Bewegung deutlich dominierte. Dies wurde in bis heute erhaltenen Dokumenten an vielen Stellen der Bewegung intensiv diskutiert, weshalb insbesondere bei der Gründung der HPG darauf geachtet wurde, zu betonen, dass es der Guerilla keineswegs darum gehe, durch einen militärischen Kampf ein freies Kurdistan bzw. später ein befreites entstaatlichtes Kurdistan zu erzwingen, sondern dass die Rolle der Guerilla immer die der Verteidigung der Gesellschaft und ihrer Errungenschaften sei. Dafür hat sich insbesondere der Vorreiter der kurdischen Freiheitsbewegung Abdullah Öcalan immer eingesetzt. Ihm ist es auch zu verdanken, dass der Krieg von Seiten der Guerilla nie eskalierte und trotz seines Ausmaßes immer versucht wurde, ihn auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Er war es auch, der wiederholt einseitige Waffenstillstände und Feuerpausen ausrief und den Dialog für eine friedliche Beendigung des Konflikts und eine demokratische Lösung der kurdischen Frage suchte und bis heute sucht. So erklärte er in einer Erklärung vom 14. Dezember 1995 – einen Tag vor Beginn des zweiten einseitigen Waffenstillstands der ARGK: »Da dieser Krieg keine grundlegende Lösung des Konflikts sein kann, wollen wir unseren guten Willen durch die von uns getroffene Entscheidung für einen Waffenstillstand bekräftigen. […] Angesichts dieser Entwicklungen [Anm.: gemeint sind die innenpolitischen Entwicklungen in der Türkei] war es – auch im Interesse des türkischen Staates und Volkes – zwingend notwendig, die Verkündung dieses politischen Schrittes nicht länger aufzuschieben, um weiteres Blutvergießen zu verhindern. Wenn es gewollt ist, können wir das Jahr 1995 mit der Beendigung des Krieges abschließen.«
»Revolutionärer Volkskrieg«
Waffenstillstände und Feuerpausen wurden jedoch immer wieder vom türkischen Staat ignoriert oder gebrochen, so dass der Krieg bis heute andauert. Auf strategischer Ebene wurde zuletzt mit der Phase des »Revolutionären Volkskrieges« (ku. şerê gelê şoreşgerî) 2012 ein entscheidender Schritt getan. Auch hier ging es vor allem darum, die Einheitlichkeit des Befreiungskampfes zu betonen und auf verschiedene Beine zu stellen.
Während die Türkei ihre Armee in den letzten Jahren immer weiter modernisiert hat und vor allem in den letzten Jahrzehnten neben hohen Rüstungsimporten stark auf den Aufbau einer eigenen Rüstungsindustrie gesetzt hat, der fast die gesamte türkische Wirtschaft und Wissenschaft zuarbeitet, hat sich die Guerilla zu einer professionellen und modernen Kraft entwickelt. Neben der Tatsache, dass die Guerilla seit ihrer Gründung zahlenmäßig massiv gewachsen ist, wurden die befreiten Gebiete ausgeweitet und in Anlehnung an die Geschichte »Medya-Verteidigungsgebiete7« genannt. Strategien wurden entwickelt, um mit teilweise primitiv anmutenden Methoden die modernste Technik ins Leere laufen zu lassen. Es wurden Kleidung und Regenschirme entwickelt, die die (Thermal-) Kameras der türkischen Armee wirkungslos machen, es wurden Tunnel und Höhlen gebaut, die einerseits jahrelangem Beschuss standhalten, andererseits einen Widerstand auch bei gegnerischem Einsatz von Giftgas ermöglichen. Es wurden kleine, autonom agierende Spezialeinheiten gebildet, die effektiv zuschlagen können. Auch ist eine Spezialisierung auf verschiedene Arten der Kriegsführung zu beobachten. Das geht so weit, dass uns mittlerweile immer wieder Videos und Bilder von Aktionen der Guerilla erreichen, die zeigen, wie mit kleinen Drohnen sogar Angriffe aus der Luft durchgeführt werden. Worin sich die Guerilla heute aber wesentlich verbessert hat, ist, dass es ihr gelingt, den Krieg auf wenige Regionen zu konzentrieren und dort trotz des Einsatzes umfangreicher technischer Mittel und der Beteiligung einer großen Zahl türkischer Soldaten auch mit wenigen Kräften, Widerstand zu leisten. Auch die Sichtbarmachung der Stärke der Guerilla hat sich von schwarzen, lauten, aber kaum erkennbaren Kassetten hin zu der Möglichkeit entwickelt, dass Menschen in aller Welt das Kriegsgeschehen Tag für Tag verfolgen können.
 Nach 39 Jahren Kampf sieht man, dass der bewaffnete Kampf auf einer ganz anderen Ebene stattfindet. Die Guerilla hat dafür gesorgt, dass sich die kurdische Befreiungsbewegung inzwischen so weit entwickelt hat, dass sie als internationaler Akteur betrachtet werden muss. Die kurdische Frage hat das Tabu verlassen und ist zu einer Realität geworden, mit der sich die ganze Welt auseinandersetzen muss. Der Beginn des bewaffneten Kampfes am 15. August 1984 war zwangsläufig überlebensnotwendig – vermutlich könnte man heute nicht mehr von einer kurdischen Gesellschaft sprechen, wenn dieser Schritt damals nicht getan worden wäre. Die Angriffe des Islamischen Staates auf die Êzîd:innen, aber auch die Politik der Türkei, Syriens, des Irak und des Iran zeigen, dass der Schutz durch die Guerilla auch weiterhin nicht an Bedeutung verloren hat, sondern im Gegenteil noch an Bedeutung gewinnt. Entscheidend ist, dass die Hoffnung auf einen friedlichen Dialog nicht aufgegeben wird. Zuletzt konnte man das Potential im Friedensprozess 2013–158 sehen und die Bereitschaft der Guerilla zeigt sich auch aktuell. Denn nachdem das Erdbeben in der Türkei im Februar ein Chaos auslöste, das die Guerilla strategisch hervorragend für sich hätte nutzen können, wurde stattdessen eine Waffenruhe ausgerufen. Das Ziel sei der Dialog und nicht das Ausnutzen des Schmerzes der Gesellschaft, hieß es in einer Erklärung des Guerillakommandanten Murat Karayilan. Wie wahrscheinlich es ist, dass der neue alte Präsident der Türkei, Recep Tayyip Erdoğan, einen friedlichen Dialog zur Lösung der kurdischen Frage anstrebt, sei dahingestellt. Fest steht nur, dass die kurdische Guerilla nach 39 Jahren stärker denn je mit ihrer Gesellschaft und ihren Bergen verbunden ist, anstatt, wie 1984 vom türkischen Staatspräsidenten versprochen, innerhalb von zwei Monaten zerschlagen zu werden. Nach wie vor gelte, wie Murat Karayilan zuletzt in einem Interview mit Blick auf das Proklamationsflugblatt vom 15. August 1984 verkündete, der Aufruf: Richtet eure Waffen nicht gegen das türkische und kurdische Volk […], sondern gegen das faschistische Regime und die faschistischen Offiziere! Man werde weiter gegen Unterdrückung und Kolonialisierung kämpfen, auch wenn das bedeute, zu den Waffen greifen zu müssen.
Nach 39 Jahren Kampf sieht man, dass der bewaffnete Kampf auf einer ganz anderen Ebene stattfindet. Die Guerilla hat dafür gesorgt, dass sich die kurdische Befreiungsbewegung inzwischen so weit entwickelt hat, dass sie als internationaler Akteur betrachtet werden muss. Die kurdische Frage hat das Tabu verlassen und ist zu einer Realität geworden, mit der sich die ganze Welt auseinandersetzen muss. Der Beginn des bewaffneten Kampfes am 15. August 1984 war zwangsläufig überlebensnotwendig – vermutlich könnte man heute nicht mehr von einer kurdischen Gesellschaft sprechen, wenn dieser Schritt damals nicht getan worden wäre. Die Angriffe des Islamischen Staates auf die Êzîd:innen, aber auch die Politik der Türkei, Syriens, des Irak und des Iran zeigen, dass der Schutz durch die Guerilla auch weiterhin nicht an Bedeutung verloren hat, sondern im Gegenteil noch an Bedeutung gewinnt. Entscheidend ist, dass die Hoffnung auf einen friedlichen Dialog nicht aufgegeben wird. Zuletzt konnte man das Potential im Friedensprozess 2013–158 sehen und die Bereitschaft der Guerilla zeigt sich auch aktuell. Denn nachdem das Erdbeben in der Türkei im Februar ein Chaos auslöste, das die Guerilla strategisch hervorragend für sich hätte nutzen können, wurde stattdessen eine Waffenruhe ausgerufen. Das Ziel sei der Dialog und nicht das Ausnutzen des Schmerzes der Gesellschaft, hieß es in einer Erklärung des Guerillakommandanten Murat Karayilan. Wie wahrscheinlich es ist, dass der neue alte Präsident der Türkei, Recep Tayyip Erdoğan, einen friedlichen Dialog zur Lösung der kurdischen Frage anstrebt, sei dahingestellt. Fest steht nur, dass die kurdische Guerilla nach 39 Jahren stärker denn je mit ihrer Gesellschaft und ihren Bergen verbunden ist, anstatt, wie 1984 vom türkischen Staatspräsidenten versprochen, innerhalb von zwei Monaten zerschlagen zu werden. Nach wie vor gelte, wie Murat Karayilan zuletzt in einem Interview mit Blick auf das Proklamationsflugblatt vom 15. August 1984 verkündete, der Aufruf: Richtet eure Waffen nicht gegen das türkische und kurdische Volk […], sondern gegen das faschistische Regime und die faschistischen Offiziere! Man werde weiter gegen Unterdrückung und Kolonialisierung kämpfen, auch wenn das bedeute, zu den Waffen greifen zu müssen.
1 Der Vertrag von Lausanne wurde am 24. Juli 1923 in der gleichnamigen Schweizer Stadt zwischen der Türkei sowie Großbritannien, Frankreich, Italien, Japan, Griechenland, Rumänien und dem Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen geschlossen. Er teilte das Osmanische Reich und ordnete den Nahen Osten in etwa so, wie wir ihn heute kennen, d.h. die Siedlungsgebiete der Kurdinnen und Kurden wurden zwischen der Türkei, Syrien, dem Iran und dem Irak aufgeteilt.
2 Am Vertrag von Sèvres vom 10. August 1920 waren das Britische Empire, Frankreich, Italien, Japan, Armenien, Belgien, Griechenland, der Hedschas, Polen, Portugal, Rumänien, das Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen sowie die Tschechoslowakei beteiligt. Es ging um die Neuordnung des Osmanischen Reiches nach dem Ersten Weltkrieg. Schon damals war Kurdistan auf mehrere Staatsgebiete aufgeteilt worden, den Kurd:innen wurde jedoch ein Autonomiegebiet in Aussicht gestellt.
3 Nach einem siebzehnjährigen Krieg zwischen dem Osmanischen Reich und dem persischen Safawidenreich, den das Osmanische Reich für sich entscheiden konnte, wurde am 17. Mai 1639 der Vertrag von Qasr-e Schirin geschlossen. Er teilte das kurdische Siedlungsgebiet und zog die Grenzen, wie sie im Wesentlichen bis heute zwischen Iran, Irak und der Türkei verlaufen.
4 Dazu gehört u. a. der türkische Zweig der Operation Gladio, einer geheimen antikommunistischen Stay-Behind-Initiative, die von den Vereinigten Staaten als Ausdruck der Truman-Doktrin unterstützt wurde. Das ursprüngliche Ziel der Operation war der Aufbau einer Guerillatruppe, um eine mögliche sowjetische Besetzung zu untergraben. Das Ziel wurde bald auf die Unterwanderung des Kommunismus und der revolutionären Bewegungen in der Türkei ausgeweitet, um einen Keil zwischen die Guerilla und die Gesellschaft zu treiben.
5 Dorfschützer sind paramilitärische Einheiten, die in Kurdistan gegen die Guerilla und unliebsame Oppositionelle eingesetzt werden. Sie bestehen zu einem beträchtlichen Teil aus Stammesführern, Großgrundbesitzern, Familien und Einzelpersonen, die oft seit Jahrzehnten mit dem Staat zusammenarbeiten und versuchen, in Kurdistan für die Interessen des Staates einzutreten. Ein Teil der Dorfschützer tritt diesem System freiwillig bei, andere werden mit Mord, Verhaftung und Vertreibung bedroht und müssen unter Druck Dorfschützer werden. Als historisches Vorbild der Dorfschützer gelten die Hamidiye-Regimenter im Osmanischen Reich.
6 Newroz ist das kurdische Neujahrsfest, das Wort bedeutet wörtlich übersetzt »Neuer Tag«. Gleichzeitig ist es aber auch ein Fest des Widerstandes, das eng mit einem nationalen Mythos der Befreiung verknüpft ist. Feuer spielt dabei eine essentielle Rolle.
7 Die Medya-Verteidigungsgebiete umfassen im Wesentlichen Gebiete in den Bergen Südkurdistans, die unter der Kontrolle der Guerilla stehen. Auch wenn die staatlichen Militärs immer wieder versuchen, dort Fuß zu fassen, gelingt es ihnen nicht, die Gebiete dauerhaft zu besetzen. Der Name »Medya« bezieht sich auf das Volk der Meder, das früher in diesem Gebiet lebte und aus dem die kurdische Nation hervorgegangen ist.
8 Mit dem Friedensprozess 2013–2015 ist die Phase gemeint, in der zwischen Erdoğan und dem türkischen Staat auf der einen Seite und der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) und ihrem Vordenker Abdullah Öcalan auf der anderen Seite unter Vermittlung der Demokratischen Partei der Völker (Halklarin Demokratik Partisi, HDP) Gespräche über eine mögliche politische Lösung der sog. kurdischen Frage geführt wurden. Nachdem die Kampfhandlungen vielerorts weitgehend eingestellt waren und der Frieden in greifbare Nähe gerückt schien, brach das türkische Regime die Gespräche plötzlich ab, ignorierte die bereits getroffenen Vereinbarungen und begann einen neuen, viel umfassenderen Krieg, der bis heute andauert.
Kurdistan Report 228 | Juli / August 2023
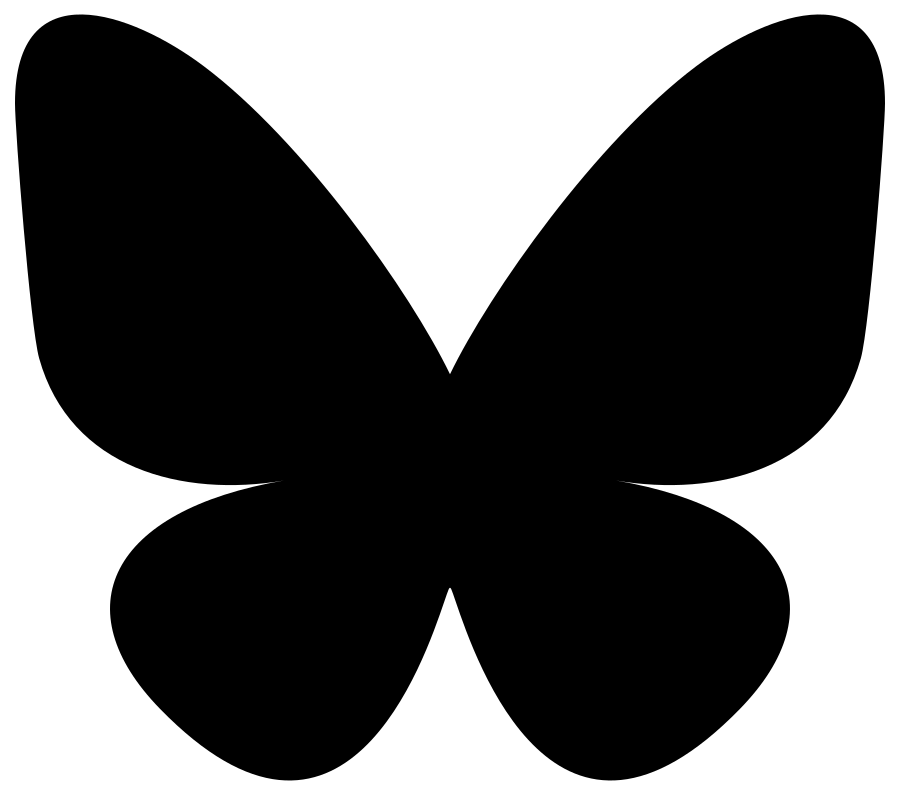

COMMENTS