Die anthropologische Neugründung des Sozialismus
Nimet Sevim, Journalist
Abdullah Öcalans paradigmatischer Wandel stellt einen der großen Umbrüche in der Geschichte des Sozialismus dar, denn dieser Ansatz bricht mit der orthodoxen Auffassung, die dem Sozialismus der Gesellschaft den Anspruch der »Wissenschaftlichkeit« aufzwingt, und schlägt ein Modell vor, das das kreative Potenzial des Menschen in den Mittelpunkt stellt. Es macht den Kampf des Menschen als soziales Wesen um die Verwirklichung seines Potenzials zur grundlegenden Dynamik des Sozialismus.
Der Übergang vom Slogan »Das Beharren auf Sozialismus ist das Beharren auf Menschsein« zur Formulierung »Das Beharren auf Menschsein ist das Beharren auf Sozialismus« ist nicht nur eine Änderung der Wortreihenfolge. Diese Umwandlung drückt eine radikale Neugründung der ontologischen Grundlagen des Sozialismus aus. Während in der ersten Formulierung der Sozialismus als Ideologie und der Mensch als Träger dieser Ideologie positioniert wird, steht in der zweiten der Mensch im Mittelpunkt und der Sozialismus wird als Praxis der Befreiung des Menschen definiert. Dieser Paradigmenwechsel ist aus einer kritischen Bewertung der staatsorientierten sozialistischen Erfahrungen des 20. Jahrhunderts hervorgegangen, bietet aber gleichzeitig eine neue sozialistische Vision als Antwort auf die ökologischen, geschlechtsspezifischen und demokratischen Krisen unserer Zeit.
Abdullah Öcalans Modell übernimmt weder den deterministischen Ansatz der zentral geplanten Wirtschaft sowjetischer Prägung noch akzeptiert es die reformistische Begrenztheit der westlichen Sozialdemokratie. Stattdessen macht es den Kampf des Menschen als soziales Wesen um die Verwirklichung seines Potenzials zur grundlegenden Dynamik des Sozialismus. Bei diesem Ansatz existiert der Sozialismus nicht als ein extern aufgezwungenes System, sondern bildet eine Lebensform, die der Mensch in seiner Praxis der Selbstbefreiung selbst entwickelt.
Die philosophischen Grundlagen dieses Paradigmenwechsels finden sich in den frühen Werken von Karl Marx, insbesondere in den Ökonomisch-philosophischen Manuskripten von 1844. Marx beschreibt dort den Kommunismus u. a. als »positive Aufhebung des Privateigentums […] als wirkliche Aneignung des menschlichen Wesens durch und für den Menschen; darum als vollständige, bewusst […] gewordene Rückkehr des Menschen für sich als eines gesellschaftlichen, d. h. menschlichen Menschen«¹.
Diese Formulierung bedeutet, dass das Leben von den Warenverhältnissen befreit und zum Produkt der eigenen schöpferischen Arbeit des Menschen wird. Der Begriff »positive Aufhebung« ist hierbei zentral: In der Tradition der Hegelschen Dialektik bezeichnet »Aufhebung« nicht nur die Beseitigung, sondern zugleich die Bewahrung und Überführung in eine höhere Form. Marx geht es also nicht um die bloße Zerstörung des Privateigentums, sondern um dessen Transformation, um das schöpferische Potenzial des Menschen freizusetzen. Diese Aneignung ist nicht individuell, sondern kollektiv. Trotz der Verwendung des Wortes »Mensch« in der Einzahl ist damit die Menschheit als Gattungswesen gemeint. Marx definiert den Menschen als sog. »Gattungswesen« und charakterisiert den Kommunismus als »echten Humanismus«. Dieser Ansatz zeigt die theoretischen Wurzeln der neu akzentuierten Formulierungen bei Öcalan.
Der Irrweg des »wissenschaftlichen Sozialismus«
Dieser in den Frühschriften von Marx vertretene Humanismus wurde jedoch in sozialistischen Experimenten des 20. Jahrhunderts weitgehend ignoriert und durch eine mechanische Gesellschaftsgestaltung unter der Bezeichnung »Wissenschaftlicher Sozialismus« ersetzt. Der Prozess, der u. a. mit Friedrich Engels’ Werk »Der Sozialismus als wissenschaftliche Revolution« begann, hatte den Anspruch, den Sozialismus als positivistische Wissenschaft zu etablieren.
Dieser Ansatz Engels‘ geht davon aus, dass die gesellschaftliche Entwicklung mit »objektiven« Gesetzen wie denen der Naturwissenschaften erklärt werden kann. Wladimir Lenins Antwort auf die Frage »Was tun?« überträgt diesen Ansatz auf die Ebene der politischen Organisation: Eine bewusste Vorreiterpartei wird den Massen die Wahrheiten des »Wissenschaftlichen Sozialismus« vermitteln und sie auf die Revolution vorbereiten. Dieses Modell reduziert den Menschen auf ein passives Objekt. Der Mensch wird nicht zum Subjekt des Sozialismus, sondern zu seinem Objekt. Die Partei hat das Wissen, die Massen lernen. Die Partei entscheidet, die Massen führen aus. Die Folgen dieses Ansatzes zeigen sich in allen Erfahrungen des Staatssozialismus, von der Sowjetunion über China bis nach Osteuropa.
Die Sowjetunion der Stalin-Ära bietet das extremste Beispiel für diesen Ansatz. Das Projekt der Schaffung eines »neuen sowjetischen Menschen« war ein Versuch, den Menschen durch »social engineering«² umzugestalten. Dahinter steht die Annahme, dass der Mensch unendlich formbar ist und unter den richtigen Bedingungen mit dem gewünschten politischen Bewusstsein ausgestattet werden kann. Kunst, Literatur und Musik wurden zu Instrumenten des Sozialismusaufbaus. Die Strömung des »Sozialistischen Realismus« ist genau das Ergebnis dieser Denkweise. Der oder die Künstler:in verliert die unabhängige kreative Identität und wird zum Propagandist:in der Partei.
Im China unter Mao Zedong zeigt die »Kulturrevolution« eine andere Version dieses Ansatzes. Das Projekt der Schaffung eines »neuen Menschen« wird als vollständige Ablehnung der traditionellen Kultur und deren Ersatz durch eine »Proletarische Kultur« definiert. Von der Familienstruktur über Kunstwerke bis hin zum Sprachgebrauch und den Praktiken des Alltags wird alles zu einem politischen Instrument, zum Ziel und Ergebnis. Das Auswendiglernen des »Roten Buches« und die Durchdringung aller Bereiche des Alltagslebens mit Maos Gedanken zielen darauf ab, die Fähigkeit des Menschen zum eigenständigen Denken auszuschalten. In diesem Prozess verlieren Millionen Menschen ihr Leben, und noch weitergehend ist, dass das kreative Potenzial der Menschen zerstört wird.
Die kubanische Revolution fügte diesem Ansatz eine romantische Note hinzu. In Che Guevaras Vorstellung vom »neuen Menschen« sollten wirtschaftliche Anreize durch moralische ersetzt werden und persönliche Interessen den Zielen der Gemeinschaft weichen. Freiwillige Arbeitseinsätze sollten verdeutlichen, dass die Beteiligung am Aufbau des Sozialismus eine moralische Pflicht ist. Dieser Ansatz wirkte zwar menschlicher als das sowjetische Modell, trug jedoch im Kern das gleiche Problem in sich: Der Mensch wurde als formbares Material für die »ideale Gesellschaft« gesehen, die der Sozialismus schaffen wollte. Das individuelle Potenzial zählte nur insoweit, wie es dem gemeinsamen Projekt diente.
Diese historischen Erfahrungen zeigen, wie der Sozialismus als ideologisches Projekt zu totalitären Ergebnissen geführt hat. Die Formel »Das Beharren auf Sozialismus ist das Beharren auf Menschsein« ist das Ergebnis genau dieses Ansatzes. In dieser »Formel« steht der Sozialismus an erster Stelle, der Mensch folgt hinterher. Der Sozialismus ist eine objektive Realität, der Mensch ist das Wesen, das diese Realität begreifen und umsetzen kann. Das Ergebnis dieses Ansatzes ist die Instrumentalisierung des Menschen, die Einengung seines kreativen Potenzials auf ideologische Schemata. Der Mensch wird nicht zum Subjekt des Sozialismus, sondern zu seinem Objekt. Er ist nicht mehr aktiver Gestalter seines Lebens, sondern passiver Träger eines großen Projekts.
Der Mensch als Subjekt im Sozialismus
Die Formel »Das Beharren auf Menschsein ist das Beharren auf Sozialismus« kehrt diesen Ansatz grundlegend um. In dieser Formel steht der Mensch an erster Stelle, der Sozialismus entsteht als Ergebnis der schöpferischen Praxis des Menschen. Menschsein ist hier kein statischer Zustand, sondern ein dynamischer Prozess. Der Mensch befindet sich in einem ständigen Kampf um die Verwirklichung seiner Potenziale und ist im Dasein ständig dabei, »Mensch zu sein«. Die soziale Dimension dieses Prozesses bringt den Sozialismus hervor. Der Sozialismus ist kein von außen aufgezwungenes System, sondern eine Lebensweise, die die Menschen in ihrer Praxis der Selbstbefreiung geschaffen haben.
Dieser Paradigmenwechsel deutet auf eine anthropologische Revolution hin. Der Mensch wird nicht mehr als ein durch eine vorgegebene Natur determiniertes Wesen verstanden, sondern als ein sich selbst schaffendes Wesen. Jean-Paul Sartres berühmte Formel »Die Existenz geht der Essenz voraus«³ bildet die philosophische Grundlage für diesen Ansatz. Sartre exponiert die Auffassung, dass der Mensch keine von Geburt an festgelegte Natur besitzt, sondern sein Wesen erst im Verlauf seines Lebens durch Entscheidungen und Handlungen formt. Dieser schöpferische Prozess vollzieht sich nicht isoliert, sondern in einem sozialen Zusammenhang: Der Mensch ist ein soziales Wesen und kann sein Potenzial nur gemeinsam mit anderen und in Beziehung zu ihnen verwirklichen.
Murray Bookchins Theorie der sozialen Ökologie stärkt die wissenschaftlichen Grundlagen dieses anthropologischen Ansatzes. Bookchin vertritt die Auffassung, dass der Mensch ein Produkt der natürlichen Evolution ist, aber gleichzeitig über ein kreatives Potenzial verfügt, das über die natürliche Evolution hinausgeht. Dieses Potenzial, das er mit dem Begriff »zweite Natur« bezeichnet, weist darauf hin, dass der Mensch ein Wesen ist, das Kultur schafft, symbolisch denken und ethische Werte entwickeln kann. Dieses Potenzial beginnt mit der biologischen Evolution, beschränkt sich aber nicht auf sie, sondern befähigt den Menschen auch seine eigene Evolution lenken zu können. Diese Lenkung muss nach Bookchins Ansicht jedoch im Einklang mit der Natur und auf der Grundlage ökologischer Prinzipien erfolgen, denn andernfalls zerstört der Mensch seine eigenen Lebensgrundlagen.
Eine weitere Dimension wird dem neuen Sozialismusansatz durch die feministische Erkenntnistheorie verliehen. Feministinnen wie Dorothy Smith, Donna Haraway und Sandra Harding betonen die soziale Verortung von Wissen. Wissen ist nicht objektiv und universell. Die soziale Position, das Geschlecht, die Klasse und die ethnische Identität des Subjekts, das Wissen produziert, spielen u. a. eine bedeutende Rolle bei der Gestaltung von Wissen. Dieser Ansatz hinterfragt eben auch den Universalitätsanspruch des »Wissenschaftlichen Sozialismus«. Welcher und wessen Sozialismus sind gemeint und aus welcher Perspektive »wissenschaftlich«? Denkschulen feministischer Erkenntnistheorie schlagen ein vielstimmiges, pluralistisches Verständnis von Wissen vor, das die Erfahrungen von Frauen, die Perspektiven von Randgruppen und die Sichtweisen der Unterdrückten für die Bereicherung des Wissens unerlässlich einschließt.
Auch die Wissenssysteme indigener Völker vertiefen diesen pluralistischen Ansatz noch weiter. Im Gegensatz zum objektivierenden, fragmentierenden Ansatz des traditionell westlichen Denk- und Wissenschaftbetriebes bieten indigene Völker ein ganzheitliches, relationales Verständnis von Wissen. Der Mensch ist Teil der Natur und kann nicht von ihr getrennt werden. Wissen ist nicht nur eine geistige Tätigkeit, sondern eine körperliche, emotionale und spirituelle Erfahrung. Dieser Ansatz definiert auch den Sozialismus auf eine andere Weise. Sozialismus ist nicht nur die Veränderung der wirtschaftlichen Beziehungen, sondern die Wiederherstellung der Beziehungen zwischen Mensch und Natur, Mensch und Mensch, Mensch und Gesellschaft.
Durch das Menschsein zum demokratischen Konföderalismus
Dieses mehrdimensionale Verständnis von Wissen bildet die erkenntnistheoretische Grundlage des demokratischen Konföderalismus. Anstelle einer zentralisierten, von oben nach unten gesteuerten Wissensproduktion setzt der demokratische Konföderalismus auf eine dezentrale, von unten nach oben wachsende Wissensentwicklung. Jede Gemeinschaft schöpft ihr Wissen aus den eigenen Erfahrungen. Dieses Wissen wird auf der Ebene der Konföderation zusammengeführt und miteinander verbunden, ohne dass eine Perspektive der anderen aufgezwungen wird. Denn jede Gemeinschaft lebt unter eigenen, spezifischen Bedingungen und entwickelt Lösungen, die genau zu diesen Bedingungen passen.
Die Ideologie der Frauenfreiheit bildet die geschlechtsspezifische Dimension dieses Ansatzes. Ausgehend von der Feststellung, dass Frauen im Laufe der Geschichte die erste ausgebeutete Gruppe waren, wird argumentiert, dass ohne Frauenfreiheit kein echter Sozialismus möglich ist. Dies unterscheidet sich jedoch vom klassischen Ansatz, der die Frauenfrage zu einem Unterthema des Sozialismus macht. Die Freiheit der Frau ist eine Voraussetzung für den Sozialismus, denn das Patriarchat ist die älteste und tiefgreifendste Form der Unterdrückung. Ohne die Überwindung dieser Form der Unterdrückung ist die Überwindung anderer Formen der Unterdrückung nicht möglich. Dieser Ansatz hebt den Sozialismus aus seiner Rolle als rein wirtschaftliches Projekt heraus und macht ihn zu einer Praxis der Befreiung, die alle Bereiche des Lebens umfasst.
Der ökologische Ansatz befasst sich mit der ökologischen Dimension des Sozialismus. Die Zerstörung der Natur durch den Kapitalismus ist nicht nur ein »Nebeneffekt«, sondern das Ergebnis der grundlegenden Logik des Systems. Unbegrenztes Wachstum, Gewinnmaximierung und Konsumkultur schaffen eine Lebensweise, die im Widerspruch zur Natur steht. Aber auch die Erfahrungen mit dem staatsorientierten Sozialismus waren aus ökologischer Sicht nicht erfolgreich. Die Umweltzerstörung in der Sowjetunion, in China und in den osteuropäischen Ländern ist nicht geringer als in den kapitalistischen Ländern, denn auch diese Länder haben das Paradigma der Industriegesellschaft übernommen. Der demokratische Konföderalismus hingegen schlägt eine ökologische Lebensweise vor. Technologien im Einklang mit der Natur, erneuerbare Energien, landwirtschaftliche Produktion und ein begrenzter, bedarfsorientierter Konsum bilden die Grundelemente dieses Ansatzes.
Dieser Ansatz definiert auch Demokratie neu. Die liberale Demokratie beschränkt sich auf das Wahlrecht im politischen Bereich. In den Bereichen Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur gibt es keine Demokratie. Die sozialistischen Länder haben die wirtschaftliche Demokratie (Planwirtschaft) der politischen Demokratie geopfert. Der demokratische Konföderalismus hingegen sieht Demokratie in allen Bereichen des Lebens vor. Wirtschaftliche Entscheidungen, Bildungspolitik, Gesundheitswesen und kulturelle Aktivitäten werden unter direkter Beteiligung der Bevölkerung festgelegt. Diese Demokratie ist nicht nur das Recht, Vertreter:innen zu wählen, sondern auch das Recht, direkte Entscheidungen zu treffen.
Die Konsensdemokratie bildet den Entscheidungsmechanismus dieses Ansatzes. Anstelle der klassischen Demokratie, in der die Mehrheit der Minderheit ihren Willen aufzwingt, wird ein Modell vorgeschlagen, in dem jeder seine Meinung äußern kann und unterschiedliche Ansichten miteinander in Einklang gebracht werden. Dieses Modell mag zeitaufwändig und mühsam erscheinen. Langfristig führt es jedoch zu mehr stabilen und legitimierten Entscheidungen, denn diese werden nicht mit Gewalt durchgesetzt, sondern durch einen gesellschaftlichen Konsens getroffen. Dieser Prozess ist gleichzeitig ein politischer Bildungsprozess der Bevölkerung. Durch Diskussionen und Verhandlungen entwickeln die Menschen ein politisches Bewusstsein.
Das Prinzip des Konföderalismus zeigt den Weg, wie diese Demokratie in großem Maßstab organisiert werden kann. Lokale Gemeinschaften verwalten ihre Angelegenheiten selbst. In Fragen, die über ihre Zuständigkeit hinausgehen, bilden sie jedoch Konföderationen mit anderen Gemeinschaften. Diese Konföderationen sind keine zentralistischen Strukturen, denn die unteren Einheiten übertragen keine Befugnisse an die übergeordneten Einheiten. Vielmehr kommen sie zusammen, um gemeinsame Probleme zu lösen. Die Konföderation sorgt lediglich für die Koordination zwischen den unteren Einheiten.
Dieses Modell bietet eine Alternative zur Nationalstaatsstruktur. Der Nationalstaat hat den Anspruch, ein homogenes Volk zu schaffen. Er versucht, verschiedene ethnische, religiöse und kulturelle Gruppen unter einer einzigen Identität zu verschmelzen. Der demokratische Konföderalismus hingegen akzeptiert und schützt Unterschiede. Jede Gruppe hat das Recht, ihre kulturellen Besonderheiten zu bewahren. Gleichzeitig lebt sie jedoch gleichberechtigt mit anderen Gruppen in einem gemeinsamen Lebensraum.
Psychologische, wirtschaftspolitische und methodologische Dimensionen des neuen Paradigmas
Die psychologische Dimension dieses Paradigmenwechsels ist ebenfalls entscheidend. Wilhelm Reichs Konzept der »Charakterpanzerung« beschreibt, wie autoritäre Systeme tief in das Unterbewusstsein eingreifen. Unterdrückerische Gesellschaftsstrukturen wirken nicht nur über äußere Institutionen, sondern auch über internalisierte Kontrollmechanismen, als eine Art »innere Polizei«, die Kreativität, Spontaneität und den Impuls zur Rebellion hemmt. Befreiung ist daher nicht allein ein politischer, sondern auch ein psychologischer Prozess. Herbert Marcuse analysiert in seinem Werk »Der eindimensionale Mensch« u. a. diesen Zusammenhang auf gesellschaftlicher Ebene: Die Konsumgesellschaft formt Bedürfnisse und Vorstellungen so, dass alternative Lebensformen kaum mehr denkbar erscheinen. In diesem Sinn bedeutet das Beharren auf der eigenen Menschlichkeit, sich gegen solche psychologischen Zwänge zu wehren, indem man die internalisierte Autorität hinterfragt und die Mechanismen löst, die das eigene kreative Potenzial blockieren.
Aus wirtschaftspolitischer Sicht bietet der demokratische Konföderalismus eine radikale Alternative zur kapitalistischen Wertetheorie. Ausgehend von Karl Marx’ Unterscheidung zwischen »Gebrauchswert« und »Tauschwert« stellt dieses Modell den Gebrauchswert in den Mittelpunkt. Die Produktion dient nicht der Gewinnmaximierung, sondern der Befriedigung gesellschaftlicher Bedürfnisse. Die Kooperativen, kollektive Mitbestimmung und Sozialbanken sind die wirtschaftlichen Instrumente dieses Ansatzes. David Kortens Vorstellung von einer Ökonomie der sog. lebendigen Systeme stärkt die theoretische Grundlage dieses Modells. Die Wirtschaft funktioniert nicht wie eine mechanische Maschine, sondern wie ein lebender Organismus. Die Prinzipien der Nachhaltigkeit, Solidarität und Gegenseitigkeit regeln die wirtschaftlichen Beziehungen. Das Konzept der Commons (Gemeingüter) steht ebenfalls im Mittelpunkt dieses Ansatzes. Wasser, Luft, Boden, Wissen und Kultur dürfen nicht im Besitz einer einzigen Gruppe sein, sondern sie müssen für alle zugänglich sein.
Die methodologischen Konsequenzen dieses Ansatzes sind tiefgreifend. Gegenüber der positivistischen Wissenschaftsauffassung, die zwischen Subjekt und Objekt unterscheidet, werden partizipative Forschungsmethoden vorgeschlagen. Paulo Freires Auffassungen in seinem Werk »Pädagogik der Unterdrückten« bildet die pädagogische Dimension dieser Methodik. Wissen ist keine Ware, die von Expertinnen und Experten an die Bevölkerung weitergegeben wird, sondern ein lebendiger Prozess, der aus den Erfahrungen der Bevölkerung selbst entsteht. Im pädagogischen Ansatz der sog. dialogischen Pädagogik verschwindet die Unterscheidung zwischen Lehrenden und Lernenden, denn alle werden in ständig wechselnden Rollen gleichzeitig als Lehrende und Lernende begriffen. Dieser Ansatz findet auch in der wissenschaftlichen Forschung Anwendung. Forschende forschen gemeinsam mit der Gesellschaft, teilen die Ergebnisse mit ihr und entwickeln gemeinsam Lösungsvorschläge.
Praxisbeispiele des neuen Paradigmas
Ähnliche Ausprägungen wie die dieses Paradigmenwechsels lassen sich in verschiedenen Befreiungsbewegungen weltweit beobachten. So orientiert sich die Zapatista-Bewegung in Mexiko am ethischen Prinzip obedecer y no mandar (»gehorchen und nicht befehlen«), bei dem das Wissen und die Erfahrungen der indigenen Bevölkerung mit Formen moderner politischer Selbstorganisation verknüpft werden. Ein weiteres Beispiel stellt die im indischen Bundesstaat Kerala praktizierte partizipative Demokratie dar, wo lokale Selbstverwaltungen unter direkter Beteiligung der Bevölkerung politische Entscheidungen treffen und umsetzen.
Die u. a. auf kooperativen Unternehmen basierende katalanische Genossenschaftsbewegung, z. B. die Mondragon-Erfahrung⁴, und praktische Beispiele der Solidarwirtschaft in Italien zeigen, wie ähnliche Prinzipien unter unterschiedlichen sozialen Bedingungen umgesetzt werden können. Die Erfahrungen mit partizipativen kommunalen Budgets in Porto Alegre⁵ sind ein wichtiges Modell für die Demokratisierung wirtschaftlicher Entscheidungen. Die praktischen Ergebnisse dieses Ansatzes lassen sich sehr deutlich in der Erfahrung Rojavas erkennen.
Die im Norden Syriens gegründete autonome Verwaltung kann als erste umfassende Umsetzung der Prinzipien der demokratischen Konföderation angesehen werden. Verschiedene ethnische Gruppen wie Kurd:innen, Araber:innen, Suryoye und Turkmen:innen sind mit einer gleichberechtigten Vertretung von Frauen und Männern in der Verwaltung vertreten. Das Fundament der Wirtschaft beruht auf Kooperativen. Der Unterricht findet in der Muttersprache statt, es wird jedoch ein mehrsprachiger Ansatz verfolgt. Frauen haben das Recht auf Selbstverteidigung, und dieses Recht ist nicht nur individuell, sondern als organisiertes Verteidigungssystem konzipiert. Es wird eine neue Epistemologie namens Jineolojî (Wissenschaft aus der Perspektive der Frau) entwickelt. Diese Erfahrung zeigt zwar, dass demokratische Verwaltung auch unter Kriegsbedingungen möglich ist, steht jedoch vor verschiedenen Herausforderungen wie Wirtschaftsembargo, militärische Angriffe, interne Widersprüche und der Widerstand traditioneller Strukturen.

Die Gesellschaft der Stadt Kobanê im Norden Syriens verwaltet sich seit über 10 Jahren selbst. In Kobanê nahm die Demokratischen Selbstverwaltung Nord- und Ostsyrien am 19. Juli 2012 ihren Anfang. Foto: ANF
Allerdings bedarf dieser Ansatz auch einer kritischen Betrachtung. Eine zu stark idealistisch geprägte Perspektive kann dazu führen, dass die einschränkenden Wirkungen materieller Rahmenbedingungen vernachlässigt werden. Unter den Bedingungen der globalen kapitalistischen Hegemonie stellt sich die Frage, inwieweit lokale Erfahrungen partizipativer Demokratie bis hin zum demokratischen Konföderalismus langfristig tragfähig sind. Zudem kann die Verwaltung multikultureller Gesellschaften die Umsetzung von Konsensdemokratie in der Praxis erschweren. Langsame Entscheidungsprozesse können in Krisensituationen ein rasches und wirksames Handeln behindern. Auch auf der Ebene der Konföderation können Koordinationsprobleme entstehen, die zu Ungleichgewichten zwischen lokalen Autonomien führen. Um einem rein idealistischen Ansatz vorzubeugen, besteht die Notwendigkeit, sich dieser Risiken bewusst zu sein und sich ihnen selbstkritisch-reflexiv zu stellen und gezielt entgegenzuwirken.
Eine neue sozialistische Vision
Dieser Ansatz eröffnet auch auf globaler Ebene neue Möglichkeiten. Die durch das System der Nationalstaaten geschaffenen Grenzen behindern die Zusammenarbeit der Völker. Der demokratische Konföderalismus hingegen bietet ein Organisationsmodell ohne Grenzen. Globale Probleme wie Umweltprobleme, Migrationskrisen und wirtschaftliche Ungleichheit können nur durch die direkte Zusammenarbeit der Völker gelöst werden. Diese Zusammenarbeit kann nicht den zwischenstaatlichen Beziehungen überlassen werden, denn Staaten stellen ihre eigenen Interessen über die Interessen der Völker.
Der Ansatz »Das Beharren auf Menschsein ist das Beharren auf Sozialismus« ist in diesem Sinne eine neue sozialistische Vision, die als Antwort auf die globalen Krisen unserer Zeit entwickelt wurde. Diese Vision sieht weder eine Rückkehr zum staatsorientierten Sozialismus des 20. Jahrhunderts vor noch akzeptiert sie die unmenschliche Logik des Kapitalismus. Sie schlägt eine neue Lebensform vor, die das kreative Potenzial des Menschen in den Mittelpunkt stellt und dieses Potenzial im Einklang mit der Natur und der Gesellschaft entwickelt. Diese Lebensform ist kein aufgezwungener, sondern ein selbst geschaffener Sozialismus. Die Menschen bauen diesen Sozialismus in ihrem Kampf um ihre eigene Befreiung auf. Und dieser Aufbauprozess ist ein nie endender Prozess, denn Menschsein ist kein vollendeter Zustand, sondern ein fortwährender Schöpfungsprozess.
¹ Karl Marx, Ökonomisch-philosophische Manuskripte (1844), Drittes Manuskript. Quelle: marxists.org.
² Gezielte gesellschaftliche Umgestaltung durch staatliche Planung und Steuerung
³ Jean-Paul Sartre, Der Existentialismus ist ein Humanismus (Originaltitel: L’existentialisme est un humanisme, 1945).
⁴ Mondragón im Baskenland ist die größte Genossenschaft der Welt. Sie ist eines der erfolgreichsten Unternehmen in Spanien.
⁵ Seit 1989 existiert das Modell der partizipativen Budgetmitbestimmung schon in Porto Alegre und dient weltweit als funktionierendes Beispiel demokratischer Partizipation.
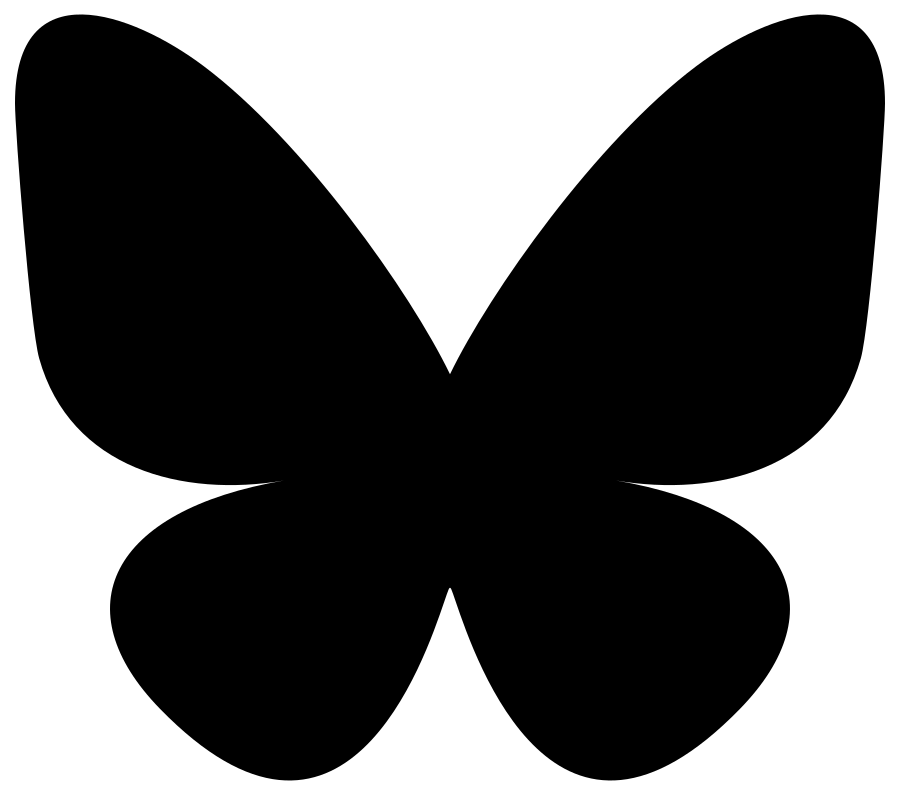


COMMENTS