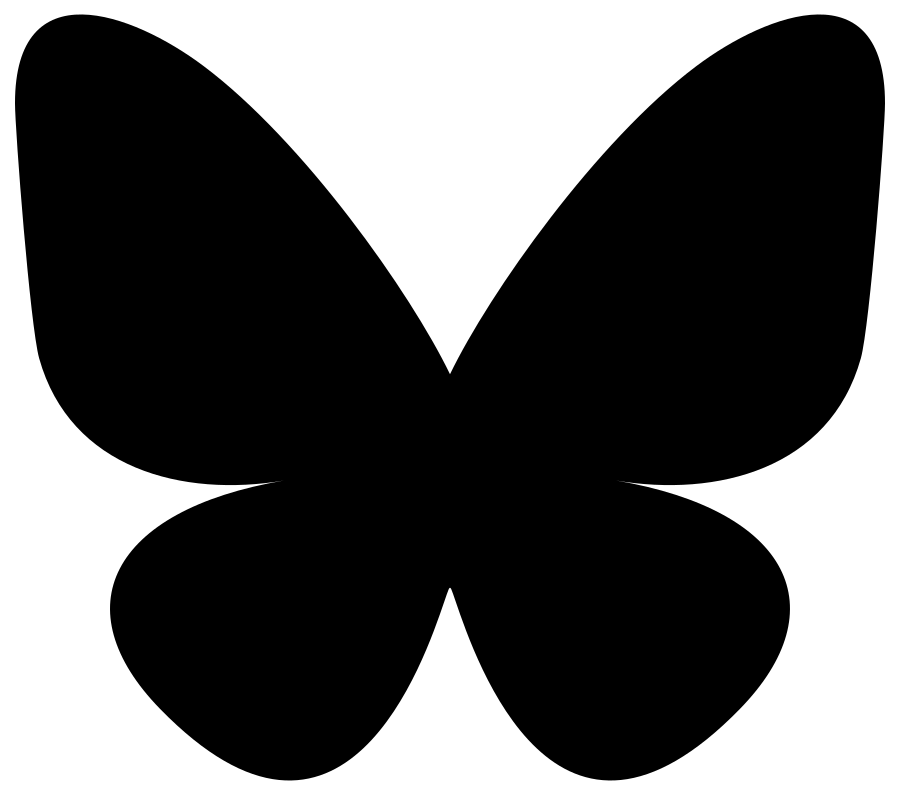Mechthild Exo, Friedensforscherin
«Der Krieg kann nicht mit militärischen Mitteln gewonnen werden. Es geht darum, dass wir als Frauen und als Gesellschaft zusammenkommen und die Grundlagen des Lebens selbst organisieren. Die Entwicklung unseres eigenen Systems, das auf Freiheit und Würde beruht, ist unsere stärkste Selbstverteidigung.«¹
Diese Aussage von Heval Canda aus dem Frauendorf Jinwar im selbstverwalteten Nord- und Ostsyrien ist kennzeichnend für das Prinzip der demokratischen Lösung im Friedenskonzept von Abdullah Öcalan. Dieses Friedenskonzept hat Öcalan 2008 mit der »Roadmap für Verhandlungen« – Friedensverhandlungen mit der türkischen Regierung um das Selbstbestimmungsrecht der Kurd:innen – ausgearbeitet. Diese Äußerung einer Bewohnerin von Jinwar ist zudem kennzeichnend für die Pionierinnenrolle der Frauen für den Aufbau von Frieden durch selbstorganisiertes Leben mit den Werten von Freiheit, Würde und – grundlegend – mit Geschlechterbefreiung.
Sowohl in Verbindung mit seinem Aufruf für Frieden und eine demokratische Gesellschaft vom 27. Februar 2025 als auch in der Friedensverhandlungsphase vor etwas mehr als 10 Jahren hat Abdullah Öcalan als der führende Repräsentant der kurdischen Bewegung für diese Verhandlungen sich explizit an die frauenpolitisch aktiven Frauen gerichtet. Dafür hat er jeweils Erklärungen zum internationalen Kampftag der Frauen, dem 8. März verfasst. In der Botschaft von 2013 formuliert er:
«Ich betrachte die Frauenfrage nicht unabhängig vom Krieg. Wie bei allen Revolutionen, auch den heutigen und insbesondere bei der Revolution in Kurdistan, ist die Frauenfrage das wichtigste Thema, das gelöst werden muss. Sie steht im Fokus aller Fragen, die den Krieg und die Entwicklung eines Friedensprozesses betreffen.«
Dieser hohe Stellenwert der Befreiung der Frauen steht in Verbindung mit der historisch-soziologischen Analyse, die die politische Philosophie Öcalans kennzeichnet. Demnach müsse, um Probleme zu lösen, dahin zurückgegangen werden, wo diese ihren Anfang hatten. Die mehr als 5000jährige Geschichte von Unterdrückungsverhältnissen begann mit der hierarchischen Geschlechterteilung zwischen Mann und Frau. Die Frau, alle Gesellschaftsverhältnisse und auch die Natur wurden dem Herrschaftsverhältnis dominanter Männlichkeit unterworfen. Entsprechend wurden Wirtschaft, Familien, Spiritualität, Wissen und alle Bereiche geordnet. Heutige Machtverhältnisse durch Nationalstaaten, Kapitalismus, Rassismus, Kolonialismus, Femizide etc. fußen auf diesen Grundlagen.
Frieden braucht Partizipation und die Überwindung des Patriarchats
Ein solches Verständnis des Zusammenhangs von Frieden und der Geschichte des Patriarchats wird auch in der Erklärung zum Antikriegstag 2022 der in der Türkei arbeitenden kurdischen Frauenorganisation Rosa sichtbar: »Frieden ist nur durch Gleichberechtigung und paritätische Partizipation möglich. Die Wurzel aller Probleme wird durch das patriarchale Denken in Hierarchien verursacht. Die älteste und am weitesten verbreitete Hierarchisierung – die Ungleichstellung von Frauen und Männern – und das patriarchale System müssen darum überwunden werden, um eine wirkliche Veränderung möglich zu machen.« Die Beteiligung von Frauen am Friedensprozess und die Behandlung der Frauenrechte an erster Stelle wurde während der Friedensverhandlung, die 2015 durch den türkischen Staat abgebrochen wurden, von Öcalan beständig eingefordert. Da das Projekt der demokratischen Gesellschaft auf der Freiheit der Frauen beruhe, wäre die Arbeit an der Frauenfrage »das Wesen und die Blüte unserer gesamten Arbeiten bei den Verhandlungen« für eine demokratische Lösung².

Die Dayikên Aşîtîiyê, die Friedensmütter rufen in Istanbul zu konkreten Schritten für einen nachhaltigen Friedensprozess in der Türkei auf: „Wir beharren auf Frieden. Jetzt ist nicht die Zeit zu schweigen – wir Mütter müssen sprechen“. Foto: ANF
Mit der UN-Sicherheitsratsresolution 1325 aus dem Jahr 2000 besteht eine internationale Verpflichtung, Frauen an Friedensprozessen gleichberechtigt zu beteiligen und die Interessen von Frauen und Mädchen einzubeziehen. Frauen unterzeichnen beinahe nie Friedensabkommen: Weniger als 3 % der Unterzeichnenden von Friedensabkommen und weniger als 10 % der Verhandlungsführenden bei Friedensgesprächen sind Frauen³. Die UN-Mechanismen zur globalen Agenda »Frauen, Frieden, Sicherheit«⁴ sind trotz des Engagements international arbeitender Frauenrechtlerinnen schwach. In Bezug auf die Friedensverhandlung von 2013 bis 2015 teilte Abdullah Öcalan in seiner Botschaft zum 8. März 2015 mit, dass auch der türkische Staat kaum Verständnis aufbrachte für seine diesbezügliche Prioritätensetzung.
Aus der feministischen Friedensforschung ist bekannt, »dass Ungleichheit zwischen Männern und Frauen zwischenstaatliche und innerstaatliche Konflikte anheizt und umgekehrt Geschlechtergleichheit solche Konflikte reduziert.«⁵ Die Konstruktion von modernen Staaten, Staatsbürgerschaft, Militarismus, Nationalismus und Krieg sind untrennbar mit den patriarchalen Geschlechterrollen und deren Festigung verknüpft. Staatsbildung wird von Bettina Roß als »männerbündisch«⁶ bezeichnet. Sie zeigt, wie bei der Entstehung moderner Staaten der Militärdienst, das Soldatentum und die Bereitschaft Krieg zu führen den Begriff eines Staatsbürgers prägten. Die Armee formt durch Unterwerfungsrituale den idealen Staatsbürger: ausschließlich Männer. Frauen sind in dieser Idee und Geschichte von Staaten nicht nur aus dem Politischen und der öffentlichen Sphäre ausgeschlossen, sondern auch zur Unterwerfung unter den Ehemann oder Vater gezwungen. Der politischen Macht des Staates wird die familiäre Gewalt des männlichen Familienoberhaupts gegenübergestellt, das Öffentliche und das Private werden getrennt. Heute können Frauen auch Soldatinnen und Ministerinnen werden, doch an der grundlegenden patriarchalen Durchdringung des Konzeptes Staat und Militär ändert das nichts.
Friedenskonzepte zwischen systemerhaltender Befriedung und Revolution
In der Friedensforschung wird Frieden zum einen als Abwesenheit von militärischer Gewaltanwendung, sogenannter negativer Frieden, definiert. Das reicht nicht aus, doch es gibt keine einheitliche und einfache Definition von Frieden. Es werden verschiedene Ebenen von Ungleichheitsverhältnissen, Gewaltformen und Diskriminierungen einbezogen und, zurückgehend auf den Friedensforscher Johann Galtung, wird auch von der notwendigen Überwindung struktureller und kultureller Gewalt gesprochen, sogenannter positiver Frieden. Kulturelle Gewalt meint dabei die Wissensformen und Normen, die Krieg legitimieren und unterstützen. Sehr verbreitet ist auch die Argumentation, positiver Frieden sei eine unerreichbare Utopie. Denn letztendlich wird hier eine herrschaftsfreie Gesellschaft anvisiert. In der kritischen Friedensforschung gibt es dennoch Vertreter:innen, die eine Bearbeitung der gesellschaftlichen Konflikte, die durch Ausbeutungs-, Entrechtungs- und Unterwerfungsverhältnisse entstehen, nicht wie üblich einfach als Konfliktbeilegung in bestehenden, machtvollen Ordnungsverhältnissen begreifen. Diese wurde historisch mit der »Erklärung zur Friedensforschung« von 1971 auch als Befriedungsforschung zurückgewiesen⁷. Es wird von einigen stattdessen die Arbeit an der notwendigen Schärfung der Konflikte für eine tiefgreifende Transformation bestehender Herrschaftsverhältnisse für notwendig erachtet. So vertrat der schwedische Friedensforscher Herman Schmid 1968 die Auffassung, dass Friedensforschung sich die Anliegen der unterdrückten und ausgebeuteten Gruppen und Nationen zur Aufgabe machen sollte. Latenten Konflikten könne Sichtbarkeit gegeben und diese geschärft werden, so dass das internationale System dadurch infrage gestellt und überwunden werden kann.⁸ Dieses Grundverständnis greift Richard Jackson, Direktor des »National Centre for Peace and Conflict Studies« in Neuseeland, wieder auf. »Konflikt zu führen ist eine notwendige Voraussetzung für die Art revolutionären systemischen Wandels, den es bedarf, um strukturelle und kulturelle Gewalt zu beseitigen«⁹. Er empfiehlt, dazu zu forschen wie Konflikte geschärft werden, damit ungerechte, Gewalt erzeugende Systemstrukturen verändert werden.
Konflikte zu schärfen meint hier eine Genauigkeit, Intensität und Tiefe in der Analyse, in Konzepten und Zielen, die Handlungen für weitreichende Veränderungen anleiten können. Es darf nicht als Härte und bewaffnete Gewalt der Konfliktaustragung missverstanden werden. Das macht Jackson deutlich, indem er einen »revolutionären Pazifismus«¹⁰ vertritt. Dieser biete das Potential, die gewalttätige Ordnung zu einer Zukunft zu transformieren, die stärker an einem positiven Frieden orientiert und sozial gerecht gestaltet ist.
Frauenorganisationen bringen die notwendige Schärfe in Konfliktbearbeitungen
Die Einflussnahme von Frauen auf Friedensprozesse und derer Beteiligung an diesen kann, das zeigen zahlreiche Beispiele, eine solche nötige Radikalität und Tiefe in die damit verbundenen Umbrüche bringen. Die Erfahrungen von Frauen in der patriarchalen Machtrealität und ihrer Rolle darin bewirken ein Verständnis der komplexen Probleme, der Konflikte sowie einen scharfen Blick für die notwendige Radikalität der Lösungen. Das umfasst unter anderem die Erfahrung der Fürsorge für das Leben, für die praktische Versorgung und den Zusammenhalt der Familie und weiterer Gemeinschaften und dabei ihre Perspektive auf die alltägliche häusliche Gewalt, sexistische Diskriminierung und Gewalt bis hin zu Femiziden sowie die erfahrene Ausgrenzung und Behinderung in Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und internationalen Beziehungen. Trotz ihrer Marginalisierung gibt es weltweit viele Beispiele dafür, wie Frauenorganisationen in Gewaltkonflikte und Friedensprozesse intervenieren.
Die Aktivistinnen der revolutionären Frauenorganisation RAWA in Afghanistan hatten bereits eine jahrzehntelange Erfahrung der Frauenorganisierung unter verschiedenen repressiven Regierungen und Kriegen als 2001 nach den Al-Qaida-Angriffen auf das World Trade Center und das Pentagon die US-Militärintervention mit weiteren Verbündeten die damalige Taliban-Regierung aus Kabul vertrieb. Die darauf folgende Militärbesatzung und die Kriegshandlungen in Afghanistan wurden mit angeblichem Demokratieaufbau und Kampf für Frauenrechte legitimiert. Jedoch wurden bereits in den ersten Wochen der Intervention die Warnungen der Feministinnen von RAWA ignoriert, dass die praktizierte Kooperation mit islamistischen Organisationen und bekannten Kriegsverbrechern bei der militärischen Intervention und dem anschließenden staatlichen Neuaufbau niemals zu Demokratie, Stabilität und Frieden führen könne. Auch die Forderungen der meist von Frauen getragenen Organisationen der Opfern von Kriegs- und Menschenrechtsverbrechen, die eine Dokumentation von Verbrechen, eine Aufarbeitung der Vergangenheit und Transitional Justice forderten, einschließlich Strafprozesse gegen die Haupttäter, wurden übergangen. Ab 2011 begann offiziell ein sogenannter Friedens- und Versöhnungsprozess mit den Taliban und der Hekmatyar-Gruppe, denen volle und unbefristete Amnestie zugestanden wurde. Das löste breit getragene gesellschaftliche Proteste aus, u.a. weil die Einbeziehung der Perspektiven der Opfer und die Forderung nach Gerechtigkeit in die Verhandlungen zurückgewiesen wurde. Vor allem Frauenrechtlerinnen protestierten gegen ihre Nicht-Beachtung und insbesondere gegen die Zugeständnisse an diese radikal-islamistischen Organisationen und die politische Integration dieser Organisationen und ihrer Führungspersonen, die für ihre frauenhassende Politik und Gewaltpraxis bekannt waren. Die Frauen mahnten, dies nicht zuzulassen, da es katastrophale Folgen für Frauen, für Menschenrechte und für den Aufbau von Frieden haben würde.¹¹ Im Friedensabkommen zwischen den USA und den Taliban und deren zentraler gemeinsamer Erklärung von 2020 kommen Frauenrechte nicht vor. Mit der darauf folgenden Machtübernahme der Taliban 2021 und deren alleiniger Regierungskontrolle über ganz Afghanistan trat ein, was die Warnungen und Protestaktivitäten der Frauenorganisationen sehr lange vorausgesehen hatten.
Indigenes Wissen verändert Friedenspraxis
Ein wenig bekanntes, aber herausragendes Beispiel für das erfolgreiche Hinwirken von Frauenorganisationen auf einen Friedensprozess, ist der nach fünf Jahrzehnten beendete bewaffnete Konflikt der indigenen Naga Nation gegen den indischen Staat. Die Friedensaktivistinnen der »Naga Mothers Association«, des Dachverbandes der Frauenorganisationen der verschiedenen Naga Stämme, haben alle bewaffneten Konfliktparteien aufgesucht und 1997 einen Waffenstillstand herbeigeführt. Zudem haben sie die Aufrechterhaltung und gesellschaftliche, demokratische Anbindung der sich über viele Jahre hinziehenden Friedensverhandlungen erreicht. Als die Naga Mothers Association ihre Kampagne gegen weiteres Blutvergießen »Shed no more blood« begann, wurde das verbunden mit ihren vorangegangenen Aktivitäten u.a. in der Gesundheitsversorgung, von sozialen Diensten für Drogenabhängige oder Kampagnen gegen Alkoholkonsum. Soziale und politische Aktivitäten wurden nicht unterschieden, sondern in einer Kontinuität begriffen. Die drängenden Bedürfnisse der Menschen und ihre alltäglichen Erfahrungen leiteten ihr Handeln. Sicherheit wurde in einem Kontinuum verstanden: vom Zuhause bis in die Gesellschaft und über die Konfliktlinien hinweg. Die Naga Frauenaktivistinnen unterteilten ihr Handeln nicht in Bereiche von »Politik«, »Wirtschaft«, »Soziales« oder andere Segmente ein.¹² Soziale, kulturelle, politische und wirtschaftliche Aspekte von Sicherheit wurden verflochten und in Wechselwirkung gesehen. Auf der Basis der Bedürfnisse der Menschen nach Gesundheit, besseren Lebensbedingungen und Frieden wurden die Prioritäten gesetzt. Auf diesem Weg haben die Naga Frauen auch ihre Rolle als Frauen innerhalb der Naga Gesellschaft von einer marginalisierten, von öffentlichem Reden und Handeln ausgeschlossenen Position radikal verändert. Seit ihrer Vermittlung des Friedensprozesses ist immer wieder der Ruf nach der Stimme »der Mütter«, der Dachorganisation der Frauen, zu hören.
Ein weiteres Beispiel einer indigenen Frauenorganisation, der »Native Women’s Association of Canada«, NWAC, zeigt besonders deutlich die Genauigkeit der Analyse und der Entscheidungen über Handlungsschritte. Das Verständnis des kolonialen Konfliktes, der historischen Erfahrung, deren Auswirkungen auf gegenwärtiges politisches Handeln und Möglichkeiten für gesellschaftliche Selbstbestimmung wird durch die Interventionen der NWAC geschärft. Der bearbeitete Konflikt ist in diesem Fall nicht ein Friedensprozess im engen Sinne. Es geht um ein Referendum zur Verfassungsänderung im Jahr 1992, mit dem die ersten Einwohner:innen, die Aborigines von Kanada, das Recht auf Selbstregierung erhalten sollten. Die Frauenorganisation NWAC lehnt ein Recht auf indigene Selbstregierung nicht ab. Dennoch wurde von NWAC, untermauert durch ein Positionspapier, 1992 gegen das neue Verfassungsrecht argumentiert. Tatsächlich wurde bei der Abstimmung von der Mehrheit der Aborigines gegen die Verfassungsänderung gestimmt, mit einem höheren Stimmenanteil als im Rest der kanadischen Bevölkerung.
Das Verständnis des Politischen hinterfragen und neu denken
Die NWAC sahen die Anliegen der Frauen am Verhandlungstisch nicht ausreichend vertreten. Bedingt durch den »Indian Act«, der Frauen von ihren Rechten ausschloss und Männer bevorzugte, waren die Führungspersonen der Aborigine Männer. Diese Männer haben sich nicht dafür eingesetzt, dass sich die Frauen bei der Verfassungsdiskussion selbst vertreten und Frauen eine Selbstregierung bilden können. Die Frauenorganisation sah deshalb eine Gefahr darin, unter diesen Bedingungen eine Selbstregierung der Aborigines in Kanada zu etablieren. Sie wollten nicht noch mehr Macht, Geld und Kontrolle in den Händen der Männer ihrer Communities sehen. Diese Männer hinterfragten die patriarchale Regierungsform nicht und sprachen fast nie von häuslicher Gewalt und Inzest, von Gangrape, Drogen- und Alkoholmissbrauch und davon, dass für Frauen und Kinder das Zuhause ein gefährlicher Ort ist und was sie dagegen tun können. »Wir wollen nicht, dass ihr in unseren Gemeinschaften Aborigines-Regierungen mit weißer Macht und weißer Philosophie aufbaut. Wir wollen nicht die westliche hierarchische Machtstruktur, die ihr uns gegeben habt.«¹³ Die patriarchalen Strukturen und Normen in ihren Communities sind eine Folge der kolonialen Praktiken. Der systematische Angriff auf traditionelle Geschlechterrollen mit einem hohen Status der Frauen und deren patriarchal-hierarchische Reorganisation mit weitgehenden Ausschlüssen der Frauen von politischen Rechten und Erbrechten, gehörten zu den kolonialen Prioritäten, um die zu unterwerfenden Gesellschaften zu schwächen und zu destabilisieren¹⁴. NWAC beklagt, dass sich einige der »Chiefs« in diesem politischen Business einrichten würden und den Frauen ihre Stimme verweigern. Die Frauen forderten deshalb Entscheidungen der gesamten Community und durch Konsens über ihre Form der Regierung. Zudem müssten Frauenrechte in der indigenen Community auch als individuelle Rechte anerkannt werden. In Richtung kanadischer Regierung erklärte die NWAC, dass die durch 400 Jahren Kolonialismus entstandenen, gravierenden sozialen, ökonomischen, kulturellen und politischen Probleme nicht einfach durch die Gewährung eines Rechts auf Selbstregierung der Aborigines gelöst würden. Die Verantwortung sei größer.
Die Aborigine Frauenorganisation NWAC hat nicht nur den vorhandenen Kontext indigener Politik auseinandergenommen, sondern auch den Raum von Politik, der durch moderne staatliche Souveränität gesetzt wird. Die Frauen stellen ein Verständnis von Politik infrage, das souveräne Staatlichkeit als die nahezu natürlich gegebene und einzig mögliche Form politischer Ordnung ansieht. Ein Bestreben, das die koloniale Erfahrung durch der Erlangung indigener Souveränitätsrechte in diesem patriarchalen, westlichen, staatlichen System zu überwinden versucht, wird durch die Frauenorganisation als zu kurz gedacht und sogar gefährlich entlarvt.
Diese Beispiele lassen erkennen, wie bedeutend sich Friedens- und anti-koloniale Transformationsprozesse durch die Involvierung der Frauen verändern bzw. verändern könnten. Es werden nicht nur weit mehr Bereiche in ihren Verwicklungen miteinander einbezogen anstatt politische, staatliche Macht isoliert und unhinterfragt zu fokussieren. Vielmehr wird neu gedacht, was Politik sein kann und umfasst.
Das Prinzip der demokratischen Lösung statt Machtteilungsdenken
Heval Candas zu Beginn zitierte Aussage zeigt auch einen solchen Bezug zu einem neuen Politikverständnis. Sie verweist indirekt auf das Prinzip der demokratischen Lösung. Dieses Prinzip ist ein zentrales Element im Friedenskonzept von Abdullah Öcalan und in der politischen Philosophie der kurdischen Bewegung. Es beruht auf einer Unterscheidung zwischen staatlichen Lösungen und demokratischen Lösungen für soziale Anliegen. Öcalan schreibt in der »Roadmap für Verhandlungen«: »Probleme gehören zur Gesellschaft und nicht zum Staat.« In einer funktionierenden demokratischen, politischen Gesellschaft ist es nicht der Staat, der im Zentrum steht. Die relevante soziale Einheit muss die Initiative ergreifen und das Problem lösen. Dabei darf die Zivilgesellschaft nicht als eine Verlängerung des Staates angesehen werden.
Ein solches Denken demokratischer Lösungen beinhaltet eine Distanz zu Macht und zu den Mechanismen von Machtkämpfen, einschließlich von Mechanismen der Machtteilung. »Das Ziel demokratischer Lösungen kann nicht die Aufteilung von Macht oder staatlicher Ressourcen sein. Den Staat zu kontrollieren und ein Teil des Staates zu werden kann nicht das Ziel demokratischer Lösung sein.«¹⁵ Im Staatsdenken verankerte Ansätze können nach dem Verständnis dieses Friedenskonzepts unmöglich die Probleme lösen. Dies ist nur durch die Methode der demokratischen Lösung möglich. Damit wird eine Demokratisierung der Gesellschaft verfolgt.
Um dieses Prinzip demokratischer Lösungen umzusetzen und nicht in den Common Sense politischer Mechanismen und Denkweisen zurückgezogen zu werden, sind im Rahmen von Friedensprozessen und beim Aufbau eines würdevollen, freien Lebens und einer demokratischen Gesellschaft die Stimme der Frauenorganisationen von höchster Bedeutung. Die vorrangige Beachtung ihrer Analysen, Ideen und Handlungsempfehlungen und die zentrale Beteiligung der Frauen bei Verhandlungen und an Entscheidungen dürfen in ihrer Bedeutung nicht unterschätzt werden. Damit liegt auch eine große, hoffnungsvolle Verantwortung bei den organisierten Frauen.
¹ Heval Canda zit. n. Herausgeber_innenkollektiv 2022: 397.
² 8. März-Botschaft 2015 von A. Öcalan.
³ Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen 2020: Frauen, Frieden, Sicherheit, Eine Welt Presse, Jg 37, 4/2020, S. 8.
⁴ Women, Peace, Security, https://wps.unwomen.org/.
⁵ Wisotzki, Simone 2008: Gender in der EU-Friedens- und Sicherheitspolitik. In: Gunda-Werner-Institut für Feminismus und Geschlechterdemokratie in der Heinrich-Böll-Stiftung (Hg.): Hoffnungsträger 1325. Ulrike Helmer Verlag, S. 46.
⁶ Roß, Bettina 2002: Krieg und Geschlechterhierarchie als Teil des Gesellschaftsvertrages. In: Harders, Cilja und Roß, Bettina (Hg.): Geschlechterverhältnisse in Krieg und Frieden. Leske + Budrich, S. 37.
⁷ Wissenschaft und Frieden 2025: Wider das Vergessen. Wie Konflikte unsichtbar werden, Jg 43, 1/2025.
⁸ Wissenschaft und Frieden 2025: Wider das Vergessen. Wie Konflikte unsichtbar werden, Jg 43, 1/2025.
⁹ Jackson, Richard 2015: How resistance can save peace studies. Journal of Resistance Studies 1(1), S. 23.
¹⁰ Jackson, Richard 2020: The revolutionary potential of pacifism. Interview von Brad Evans 9.11.2020, https://lareviewofbooks.org/article/histories-of-violence-the-revolutionary-potential-of-pacifism/.
¹¹ Vgl. Exo, Mechthild 2017: Das übergangene Wissen.
https://www.transcript-verlag.de/media/pdf/8f/9c/0a/oa9783839438725.pdf
¹² Vgl. Machanda, Rita 2004: We Do More Because We Can. Naga Women in the Peace Process. Kathmandu: South Asia Forum for Human Rights.
¹³ NWAC Positionspapier, 2.2.1992.
¹⁴ Shaw, Karena 2008: Indigeneity and Political Theory. Routledge.
¹⁵ Öcalan, Abdullah 2012: The Road Map to Negotiations. International Initiative Edition.
Titelbild: RAWA, die Revolutionären Vereinigung der Frauen Afghanistans, kämpft seit 1977 für Menschenrechte und die Rechte von Frauen. Diese Foto zeigt eine Demonstration der Frauenorganisation im Jahr 1998 in Peschawar, Pakistan. Foto: RAWA